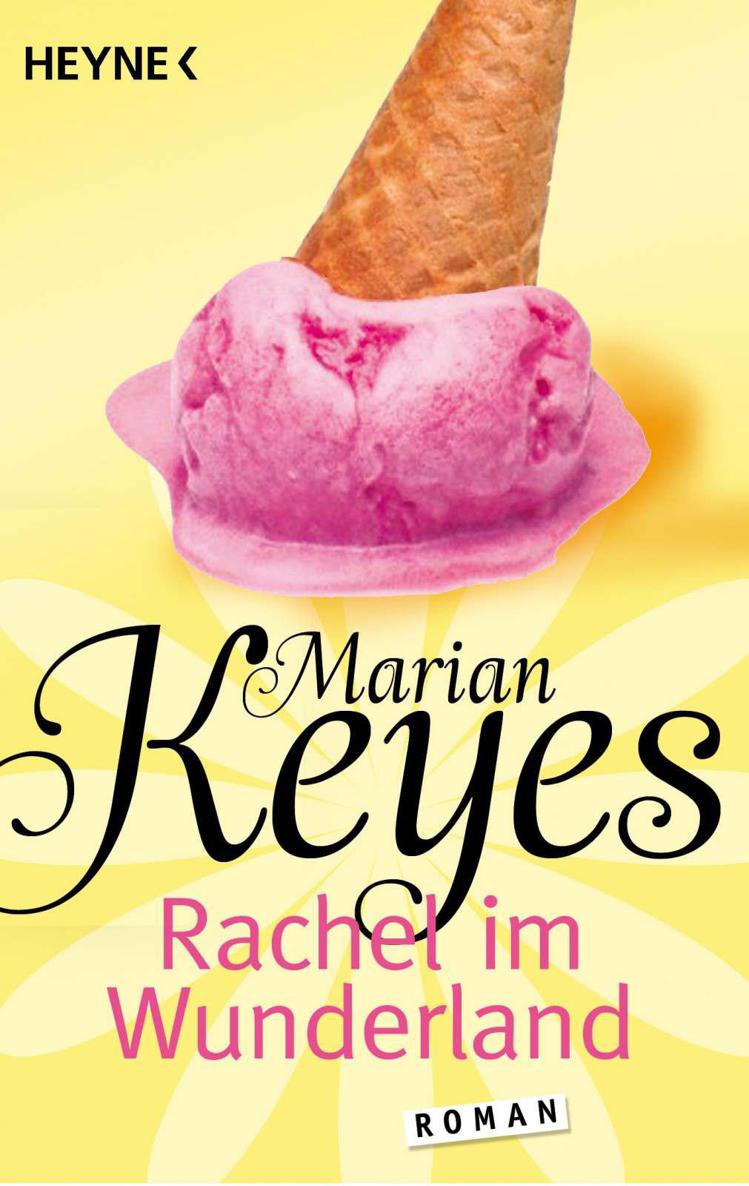![Rachel im Wunderland: Roman (German Edition)]()
Rachel im Wunderland: Roman (German Edition)
Schlaftabletten. Nach ungefähr zehn Minuten war ich immer noch wach, also nahm ich gleich noch mal zwei. Trotzdem konnte ich nicht zur Ruhe kommen, und aus lauter Verzweiflung – ich musste unbedingt ein paar Stunden schlafen, um für die Arbeit fit zu sein – legte ich noch ein paar nach.
Endlich schlief ich ein. Es war ein wunderbarer, tiefer Schlaf. So wunderbar und tief, dass ich am Morgen, als der Wecker klingelte, ganz vergaß aufzuwachen.
Brigit, meine Mitbewohnerin, klopfte an die Tür, dann kam sie in mein Zimmer und schrie mich an, dann schüttelte sie mich und, in letzter Not, schlug sie mir ins Gesicht. (Das mit dem »in letzter Not« nehme ich ihr nicht ab. Es muss ihr klar gewesen sein, dass ich davon nicht aufwachen würde. Aber schließlich ist am Montagmorgen keiner gut drauf.)
Doch dann fiel Brigits Blick zufällig auf ein Stück Papier, auf das ich noch kurz vorm Einschlafen ein paar Worte gekritzelt hatte. Es waren die üblichen lyrischen Ergüsse, wie ich sie manchmal, wenn ich unter Drogen stand, zu Papier brachte: weinerlich, rührselig und selbstgefällig. Jedes Mal hielt ich mein Geschreibsel für irrsinnig tiefschürfend und dachte, ich hätte das Geheimnis des Universums entdeckt, aber wenn ich es bei kaltem Tageslicht las, vorausgesetzt, ich konnte es überhaupt lesen, trieb es mir die Schamesröte ins Gesicht.
Das Gedicht ging ungefähr so: »Brummel, brummel, das Leben ...«, das Nächste war unleserlich, »Schale voller Kirschen, brummel, und ich krieg die Kerne ...« Und dann – daran kann ich mich vage erinnern – fiel mir ein wirklich guter Titel für ein Gedicht über eine Ladendiebin ein, die pötzlich ihr Gewissen entdeckt. Er lautete: Ich mag nicht mehr.
Aber Brigit, die in letzter Zeit so komisch und empfindlich war, hat es nicht für das peinliche Gewäsch gehalten, das es eindeutig war, sondern sie kam, als sie auch noch das leere Schlaftablettenröhrchen auf meinem Kissen sah, zu dem Schluss, dass es ein Abschiedsbrief war. Und bevor ich wusste, wie mir geschah – buchstäblich bevor ich es wusste, denn ich schlief ja noch, beziehungsweise ich war bewusstlos, wenn man der Version der anderen Glauben schenkt –, hatte sie den Notarzt gerufen, und ich wurde ins Mount-Sinai-Krankenhaus verfrachtet, wo sie mir den Magen auspumpten. Das war schon nicht sehr angenehm, aber es kam noch schlimmer. Brigit hatte sich offensichtlich zu einer Enthaltsamkeitsfanatikerin entwickelt, von denen es in New York inzwischen wimmelt; die stempeln einen zum Alkoholiker ab, wenn man sich mehr als zweimal in der Woche die Haare mit Bierschampoo wäscht, und drücken einem dann gleich das Zwölf-Schritte-Programm auf. Sie rief also meine Eltern in Dublin an und sagte ihnen, dass ich Drogenprobleme hätte und gerade versucht hätte, mich umzubringen. Und bevor ich mich einschalten konnte, um zu erklären, dass es sich um ein peinliches Missverständnis handelte, hatten meine Eltern schon meine entsetzlich brave Schwester Margaret angerufen. Die kam dann auch prompt mit dem ersten Flug aus Chicago, den sie kriegen konnte, zusammen mit Paul, ihrem ebenfalls entsetzlichen Mann.
Margaret ist nur ein Jahr älter als ich, aber sie kam mir eher wie vierzig vor. Sie war fest entschlossen, mich nach Irland in den Schoß der Familie zu befördern. Und dort würde man mich nach kurzem Zwischenaufenthalt in eine Art Betty-Ford-Klinik einweisen, wo sie mir »ein für alle Mal«, wie mein Vater sagte, als er anrief, den Kopf zurechtsetzen würden.
Ich hatte natürlich nicht die geringste Absicht, überhaupt zu verreisen, aber inzwischen bekam ich es richtig mit der Angst zu tun. Nicht nur, weil alle davon redeten, dass ich nach Hause und in so ein Sanatorium kommen sollte, sondern weil mein Vater mich angerufen hatte. Er hatte mich angerufen. Das war in den ganzen siebenundzwanzig Jahren meines Lebens noch nie passiert. Es war schon schwer genug, ein Hallo aus ihm herauszubekommen, wenn ich zu Hause anrief und er zufällig am Apparat war. Meistens reichte es nur für: »Wer ist es denn? Ach, Rachel? Warte, deine Mutter kommt schon.« Danach hörte man nur noch das Knallen des Hörers, bevor er Mum holte.
Wenn Mum nicht da war, geriet er in Panik. »Deine Mutter ist nicht da«, sagte er dann, und seine Stimme wurde schrill vor Angst. Was er eigentlich sagte, war: »Bitte, verlang nicht, dass ich mit dir spreche.«
Es lag aber nicht daran, dass er mich nicht mochte oder dass er ein strenger,
Weitere Kostenlose Bücher