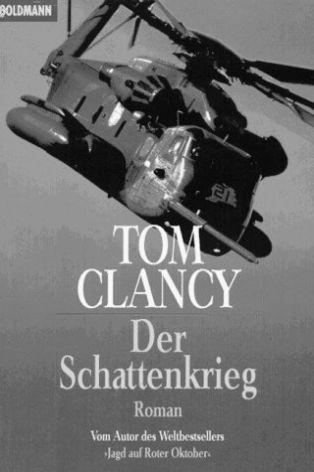![06 - Der Schattenkrieg]()
06 - Der Schattenkrieg
Führung kein Kapitänspatent erforderlich war. Sie bot fünfzehn Personen und zwei Mann Besatzung Unterkunft und war zwei Millionen Dollar wert. Der Eigner, ein Baulöwe aus Mobile, war auf See relativ unerfahren und daher vorsichtig. Klug von ihm, dachte Wegener. Zu schlau also, um sich so weit von der Küste zu entfernen. Ein Patrouillenflugzeug hatte die Jacht am Vortag ausgemacht, aber nicht versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Der Bezirkskommandeur hatte entschieden, daß hier etwas nicht stimmte. Panache war der nächste Kutter, und Wegener hatte den Auftrag bekommen, nach dem Rechten zu sehen.
»Sechzehntausend Yard, Kurs null-sieben-eins«, meldete Chief Oreza vom Radargerät. »Fahrt zwölf Knoten. Auf Mobile hält der nicht zu, Captain.«
»Der Nebel wird sich in einer guten Stunde auflösen«, entschied Wegener. »Fangen wir ihn jetzt ab. Kurs, Chief?«
»Eins-sechs-fünf, Sir.«
»Das ist dann unser Kurs. Wenn sich der Nebel hält, nehmen wir eine Änderung vor, wenn wir bis auf zwei oder drei Meilen herangekommen sind; dann setzen wir uns in sein Kielwasser.« Ensign O’Neil gab dem Rudergänger die entsprechenden Anweisungen. Wegener trat an den Kartentisch.
»Was meinen Sie, wo er hinwill, Portagee?« Der Obersteuermannsmaat zeichnete den Kurs fort, der zu keinem bestimmten Ziel zu führen schien. »Hm, er macht seine wirtschaftlichste Fahrt… einen Hafen im Golf läuft er wohl kaum an.« Der Captain griff nach einem Stechzirkel und ließ ihn über die Seekarte marschieren.
»Die Jacht hat Treibstoff an Bord für…« Wegener runzelte die Stirn. »Sagen wir, er hat im letzten Hafen nachgebunkert. Bis zu den Bahamas schafft er es dann mit Leichtigkeit. Dort nimmt er neuen Treibstoff an Bord, und dann ist für ihn jeder Ort an der Ostküste erreichbar.«
»Also Cowboys«, meinte O’Neil. »Seit langer Zeit mal wieder einer.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sir, wenn ich eine so große Jacht hätte, würde ich nicht so wie er ohne Radar durch den Nebel fahren.«
»Hoffentlich liegen Sie da falsch«, sagte der Captain. »Nun, in einer Stunde wissen wir Bescheid.« Er schaute wieder hinaus in den Nebel. Die Sichtweite betrug keine zweihundert Meter. Dann beugte er sich über das Radargerät, dachte eine Minute lang nach und schaltete das Gerät von »aktiv« auf »bereit«. Bei der Küstenwache hieß es, die Drogenschmuggler verfügten inzwischen über ESMGeräte, die sie vor Radaremissionen warnten.
»Wenn wir bis auf vier Meilen herangekommen sind, schalten wir es wieder ein.«
»Aye, Captain.« Der Ensign nickte. Wegener machte es sich auf seinem Ledersessel bequem und holte die Pfeife aus der Brusttasche. Inzwischen stopfte er sie immer seltener, aber sie gehörte halt zu dem Image, das er sich aufgebaut hatte. Wenige Minuten später war auf der Brücke wieder alles normal. Oreza brachte sein berühmtes Gebräu in einem Becher, wie er bei der Küstenwache benutzt wird unten breit und mit Gummiboden für sicheren Stand bei starkem Seegang, oben eng, um das Überschwappen zu verhindern.
»Danke, Chief«, sagte Wegener und nahm den Becher. »Eine Stunde noch, schätze ich.« »Schätze ich auch«, stimmte Wegener zu. »Um sieben Uhr fünfundvierzig gehen wir auf Gefechtsstation. Wer hat Wache?«
»Mr. Wilcox, Kramer, Abel, Dowd und Obrecki.«
»Hat Obrecki so etwas schon einmal gemacht?«
»Er ist auf einer Farm aufgewachsen und kann mit einem Gewehr umgehen, Sir. Riley hat ihn geprüft.«
»Lassen Sie Kramer von Riley ablösen.«
»Stimmt etwas nicht, Sir?«
»Ich habe ein ungutes Gefühl«, meinte Wegener. Oreza holte Riley, und dann besprach sich der Captain auf der Brückennock mit den beiden Chiefs.
Die Panache rauschte mit voller Kraft durch die Wogen. Das Schiff war auf dreiundzwanzig Knoten ausgelegt, schaffte aber bei leichtem Seegang und mit frisch gestrichenem, von Ablagerungen freiem Rumpf gelegentlich fünfundzwanzig. Nun aber lief es gerade einmal knapp zweiundzwanzig Knoten, obwohl die Turbolader Luft in die Diesel drückten. Dabei stampfte es schwer; die Brückenbesatzung kompensierte die Bewegungen durch breitbeiniges Stehen. Der Nebel ließ die Scheiben beschlagen. Ensign O’Neil schaltete die Wischer ein, trat dann wieder hinaus auf die Nock und starrte hinaus in den Nebel. Fahren ohne Radar war ihm unangenehm. O’Neil lauschte, hörte aber nur das gedämpfte Grollen der eigenen Maschinen. Er schaute noch einmal nach achtern und ging dann zurück ins Ruderhaus.
»Kein Nebelhorn zu
Weitere Kostenlose Bücher