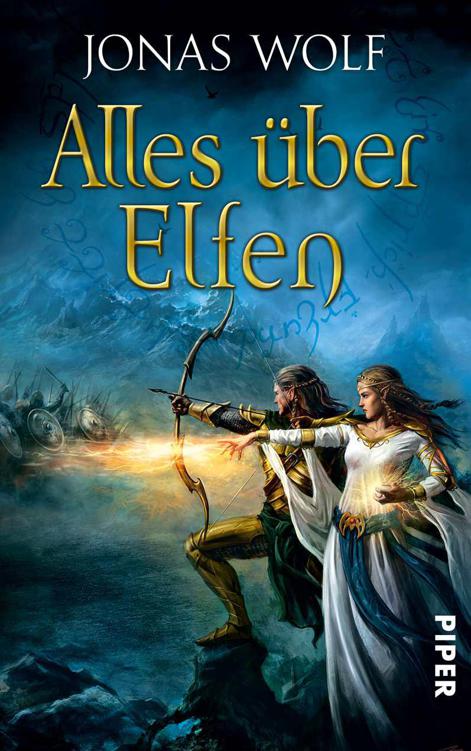![Alles über Elfen (German Edition)]()
Alles über Elfen (German Edition)
Zeit etablierte, ist die zwischen Seelie und Unseelie . Kocht man es enorm vereinfacht herunter, sind die Seelie die guten und die Unseelie die bösen Feengeschöpfe. Näher an der Wahrheit und dem Wortstamm dieser beiden Bezeichnungen wäre es jedoch, die Seelie als die Feen zu begreifen, die mit ihrer Existenz glücklich sind, und die Unseelie als diejenigen, bei denen dies nicht Fall ist. Letzteres führt dann zu einem garstigeren Verhalten uns Menschen gegenüber – einschließlich solch unschöner Dinge wie Entführungsversuchen, nächtlichen Attacken, Flüchen und hartnäckigen Belästigungen. Die Seelie hingegen stehen den Menschen weitaus offenherziger gegenüber. Damit ist jedoch keinesfalls gemeint, dass ein Seelie Menschen prinzipiell und unter allen Umständen wohlgesonnen ist. Genau wie ein mürrischer Unseelie auch einmal einem verirrten Kind den Weg nach Hause zeigen oder einem Menschen auf andere Weise Unterstützung angedeihen lassen kann, kann ein Seelie – wenn er denn gerade übler Laune ist – einem gewöhnlichen Sterblichen durchaus schaden. Als lose Faustregel gilt: Ein Seelie spricht eine Warnung aus, ehe er Rache für eine empfundene Beleidigung nimmt, wohingegen ein Unseelie sich mit solchen Nettigkeiten nicht unbedingt lange aufhält.
Eine andere Übersetzung für Seelie und Unseelie ist »lichte« bzw. »dunkle« Feen, was nur weiter betont, was man auch als Elfologe zu Beginn seiner Karriere rasch bemerkt: Diese Einteilung erinnert generell stark an die in Licht- und Schwarz- bzw. Dunkelalben. Noch dazu kommt, dass in Bezug auf Seelie und Unseelie oft von »Höfen« gesprochen wird, worin natürlich jene feudalistische Grundstruktur des Schönen Volkes mitschwingt, wie sie von Tolkien beschrieben wurde. [Plischke: Worüber diese Höfe denn nun aber genau herrschen, variiert von Beschreibung zu Beschreibung: Mal ist der eine für den Tag und der andere für die Nacht oder die »lichten« Elfen für Frühling und Sommer und die »dunklen« für Herbst und Winter zuständig – um nur zwei der einfachsten Zuschreibungen zu nennen. ]
Noch deutlicher werden die Parallelen, wenn wir in die Geschichte der Sidhe eintauchen. In einer Vielzahl von Texten aus der gälischen Mythologie, die allerdings zum Teil erst lange nach der verhältnismäßig frühen Christianisierung Irlands im 4. Jahrhundert niedergeschrieben wurden, werden die Sidhe mit den Tuatha dé Danann in Verbindung gebracht – eines der mehreren alten Geschlechter, die vor den »heutigen« Iren die Insel besiedelten. Die Tuatha dé Danann waren mit beeindruckenden magischen Talenten ausgestattet und verstanden sich auf die Fertigung absolut atemberaubender Artefakte. So wird einem ihrer Könige beispielsweise ein voll funktionsfähiger Arm aus Silber gebaut, damit er überhaupt den Thron besteigen kann – körperliche Vollkommenheit war dafür eine Grundvoraussetzung. Später wird diese grässliche, aus einer Schlacht herrührende Verstümmelung sogar gänzlich geheilt, doch für mich bleibt der Silberarm die imposantere Errungenschaft – in ihr scheinen das handwerkliche Geschick und die beispiellose Zaubermacht der Elfen, wie sie Tolkien immer wieder hervorhebt, perfekt zusammenzuspielen.
Überhaupt ist es für einen Elfologen sehr fruchtbar, Tolkiens Variante der Geschichte des Elfenvolks mit der aus den gälischen Überlieferungen abzugleichen. Hier wie dort spielen sehr ähnliche Faktoren eine entscheidende Rolle:
Abstammungs- und Thronfolgefragen, die nicht selten in Bruderzwiste münden,
groß angelegte Auszüge aus alten Heimaten in neue, unerforschte Gebiete,
magische Waffen und auf ausgeklügelten Zaubern basierende Listen sowie
Schlachten, die über das Schicksal ganzer Völker, wenn nicht gar der bekannten Welt entscheiden.
Einer dieser Schlachten haben die Sidhe auch angeblich ihren Namen zu verdanken. Sie erklärten sich gegenüber ihren Gegnern als geschlagen und zogen sich – wohl um einer völligen Auslöschung zu entgehen – unterirdisch in die zahlreichen natürlichen sowie künstlichen Hügel zurück, die man in Irland allerorten findet. Selbige heißen nämlich Sidhe, und allem Anschein nach wurden die Bewohner dieser Hügel dann praktischerweise auch gleich so benannt wie ihre Wohnstätten selbst. [Christiansen: Tolles Prinzip. Wir sollten uns Menschen fortan Häuser nennen. Das macht doch alles viel leichter für die Spezies, die uns irgendwann ersetzt. »Wer hat in all diesen alten Häusern
Weitere Kostenlose Bücher