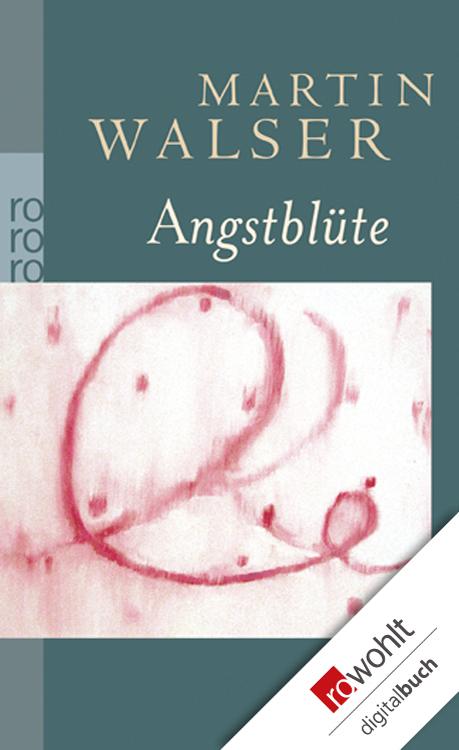![Angstblüte (German Edition)]()
Angstblüte (German Edition)
Abertausende, die sich auch vom Rauchen befreien wollten, schlossen sich an, machten mit, meldeten ihre Siege und ihre Niederlagen. Gundi selber kämpfte sich von vierzig auf fünfunddreißig, auf dreißig, und ab zwanzig in Zweierschritten herunter, bis sie die Null erreicht hatte und – das war spannend genug – die Null hielt und wieder fiel und sich wieder erhob, bis sie einhundert Tage rein durchgestanden und damit einen neuen Standard der Selbstüberwindung geschaffen hatte. Und das führte die Frau vor, die Selbstbeherrschung verachtete, die das Evangelium der Haltlosigkeit verkündete und vorlebte und ihren mehr oder weniger leidenden Gästen als einzige Heilchance empfahl. Es dürfe nichts geben, an das man sich gebunden fühlen müsse. Weder das Rauchen noch das Nichtrauchen. Das Fernsehen mußte einen Arbeitsstab einrichten und eine Bewertungsmethode entwickeln: Wer weniger als dreißig rauchte, rangierte im Achtelfinale, weniger als zwanzig im Viertelfinale, mit zehn kam man ins Halbfinale, ab null war man im Finale, aber erst nach einhundert Tagen war man Champion oder Championesse. Das waren mediengerechte Vorgänge. Das sogenannte Keppeletui mit seinem transluziden Emailledekor in Königsblau und den schmalen Goldstreifen und der honiggoldene Aschenbecher blieben auf ihrem Tisch als Schönheitsdenkmal für ihre Raucherzeit. Sie hatte diesen Aschenbecher aus dem Jahr 1924 und dieses Zigarettenetui wie alle ihre wunderbaren Dinge liebevoll vorgestellt und hingebungsvoll benutzt. Man muß nicht dagegen sein, geraucht zu haben. Vor allem, wenn man nicht mehr raucht. Was transluzid sei, habe sie zwar gesehen, aber sie habe nicht gewußt, daß das, was sie sah, transluzid genannt werde. Ihr Liebster habe es ihr erklärt. Sie lasse sich von ihrem Liebsten gern etwas erklären, weil sie dabei erlebe, wie gut ihm das tue, wenn er ihr etwas erklären könne. Dazu komme allerdings, daß außer Gott keiner so allwissend sei wie ihr Liebster. Sie frage ihn eins, und er erkläre ihr alles. Wer, wenn nicht ihr Liebster, hätte ihr sagen können, daß das transluzide Keppeletui geschaffen worden ist von Henrik Emanuel Wigström, und zwar geschaffen für Fabergé, das Goldschmiedgenie der Romanows, und daß eben dieses Etui, das da vor ihr auf dem Tisch liegt, vom englischen König Edward VII. seiner Geliebten Alice Keppel geschenkt worden ist, und wer war denn diese Alice Keppel, fragt sie dann natürlich ihren Liebsten, und hört, das war die Großmutter von Camilla Parker Bowles, und jetzt kann sie wieder mithalten, Camilla Parker Bowles, zuerst Jahr für Jahr unbeirrbare Geliebte von Prinz Charles und schließlich seine Gattin, also Nachfolgerin der märchenreifen Diana.
Das schlenkert sie allen ihren Zuschauern und speziell Barbara Steinbrech hin, ihrem heutigen Gast. Die hatte vorher bis zum Stimmversagen hervorgebracht, daß sie lieber ihre Kinder verliere als ihren Geliebten, obwohl sie doch ohne ihre Kinder überhaupt nicht leben könne, und beide Unmöglichkeiten habe sie durch und durch erfahren, also habe sie erfahren, daß sie nicht mehr leben könne. Und Gundi, nach ihrem schwebend leichten Bildungsschlenker zu Transluzid und Edward-Alice-Charles-Camilla, holt jetzt aus: Weg mit der verhinderungssüchtigen Wirklichkeit, in der so gut wie nichts möglich ist. Vor allem nichts Schönes. Schluß mit der Vorherrschaft des Wirklichkeitsprinzips. Wenigstens hier, bei Gundi, mit Gundi, durch Gundi, um Gundi herum. Alles ist möglich. Wir müssen es nur zulassen. Und griff nach ihrem Aschenbecher, fingerte aus dem transluzid schimmernden Keppeletui eine Zigarette, zündete ein zehn Zentimeter langes Zündholz an und sagte: Frau Steinbrech, mit dieser Heiligsprechung der Unmöglichkeit zwingen Sie mich dazu, wieder zu rauchen. Wenn etwas unmöglich ist, bleibt nur noch das Rauchen. Frau Steinbrech stieß einen Schreckschrei aus, fiel ihr in den Arm beziehungsweise blies das Zündholz aus und sagte Gundi etwas ins Ohr. Gundi zerbrach die Zigarette, streichelte Frau Steinbrech ausgiebig. Dann sagte sie: Irgendwo habe ich von Karl Marx den Satz gelesen: In einer kommunistischen Gesellschaft gibt es keine Maler, sondern höchstens Menschen, die unter anderem auch malen. Ist das nicht ein wunderbarer Satz, rief sie dann. Barbara Steinbrech, sagt Ihnen der Satz etwas? Und Frau Steinbrech zögerte, kaute auf dem Wort kommunistisch herum. Lassen Sie’s einfach weg, sagte Gundi. Kommunistisch, das war, als Marx es
Weitere Kostenlose Bücher