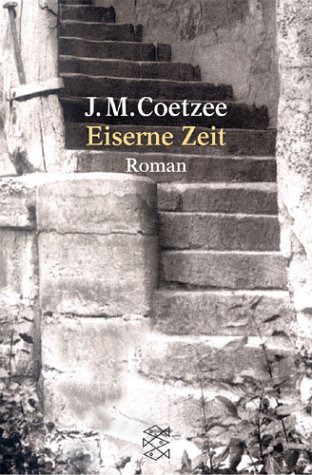![Coetzee, J. M.]()
Coetzee, J. M.
wurde
er kurz wieder wach. »Das Fahrrad«, murmelte er.
»Das ist in
Sicherheit, ich hab es aufbewahrt. Es muß nur repariert werden. Ich werde Mr.
Vercueil bitten, sich das mal anzusehn.«
So wird dieses Haus, das
einmal mein Zuhause war und Deines, zu einem Zufluchtsort, einem
Durchgangsheim.
Mein liebstes Kind, ich
befinde mich in einem Nebel des Irrtums. Es ist spät geworden, und ich weiß
nicht, wie ich mich retten soll. Soweit ich beichten kann, beichte ich Dir. Was
mein Irrtum ist, fragst Du? Wenn ich ihn wie eine Spinne in eine Flasche
stecken und Dir zur Untersuchung schicken könnte, würde ich es tun. Aber er ist
wie ein Nebel, überall und nirgendwo. Ich kann ihn nicht anfassen, einfangen,
benennen. Langsam jedoch und widerstrebend sage ich das erste Wort. Ich liebe
dieses Kind nicht, das Kind, das in Florences Bett schläft. Ich liebe Dich,
aber diesen Jungen liebe ich nicht. Nichts zieht mich zu ihm, aber auch gar
nichts.
Ja, erwiderst Du, er ist
nicht liebenswert. Aber hast Du nicht Deinen Teil dazu beigetragen, ihn
unliebenswert zu machen?
Das leugne ich nicht.
Zugleich aber glaube ich es nicht. Mein Herz akzeptiert ihn nicht als den
meinen: so einfach ist das. Ich wünsche von Herzen, daß er geht und mich allein
läßt.
Das ist mein erstes Wort,
das erste, was ich zu beichten habe. Ich will nicht sterben in dem Zustand, in
dem ich jetzt bin, in einem Zustand der Häßlichkeit. Ich will gerettet werden.
Wodurch kann ich gerettet werden? Dadurch, daß ich tue, was ich nicht tun will.
Das ist der erste Schritt: das weiß ich. Ich muß lieben, vor allem das
Unliebenswerte. Ich muß beispielsweise dieses Kind lieben: nicht den
aufgeweckten, kleinen Bheki, sondern diesen Jungen. Es hat einen Grund, daß er
hier ist. Er ist ein Teil meiner Errettung. Ich muß ihn lieben. Aber ich liebe
ihn nicht. Ich will ihn auch nicht genügend lieben, um ihn mir zum Trotz zu
lieben.
Und weil ich nicht aus
ganzem Herzen anders sein will, wandere ich noch immer in einem Nebel.
Ich kann ihn nicht finden
in meinem Herzen: den Wunsch zu lieben, den Wunsch, lieben zu wollen.
Ich sterbe, weil ich nicht
von Herzen wünsche zu leben. Ich sterbe, weil ich sterben will.
Darum laß
mich nun mein zweites, zweifelhaftes Wort äußern. Da ich ihn nicht lieben will,
wie wahr kann es dann sein, wenn ich sage, meine Liebe gilt Dir? Denn Liebe ist
nicht wie Hunger, Liebe ist nie gesättigt, gestillt. Wenn man liebt, liebt man
mehr. Je mehr ich Dich liebe, um so mehr sollte ich ihn lieben. Je weniger ich
ihn liebe, um so weniger liebe ich vielleicht Dich.
Kreuzförmige Logik, die
mich führt, wohin ich nicht will! Aber würde ich mich auf sie festnageln
lassen, wenn ich es nicht wirklich wollte?
Ich dachte, als ich diesen
langen Brief begann, daß sein Sog so stark sein würde wie der der Ebbe, daß
unter den Wellen, die an der Oberfläche hierhin und dorthin schlagen, ein Zug
sein würde, so konstant, wie der Mond Dich zu mir zieht und mich zu Dir, der
Zug des Blutes von Tochter zu Mutter, von Frau zu Frau. Aber mit jedem Tag, den
ich ihm hinzufüge, scheint der Brief abstrakter zu werden, abstrahierter, die
Art Brief, die man von den Sternen schreibt, aus der entfernteren Leere,
entkörperlicht, kristallin, blutlos. Soll das das Schicksal meiner Liebe sein?
Ich
erinnere mich, als der Junge verletzt wurde, wie heftig er blutete, wie stark.
Wie dünn ist dagegen mein Bluten auf das Papier hier. Die Ergießung eines
geschrumpften Herzens.
Ich habe bereits über Blut
geschrieben, ich weiß. Ich habe über alles geschrieben, ich bin
leergeschrieben, ausgeblutet, und mache noch immer weiter. Dieser Brief ist ein
Labyrinth geworden, und ich ein Hund in dem Labyrinth, hin und her rennend
durch die Abzweigungen und Unterführungen, kratzend und winselnd an denselben
alten Stellen, ermüdend, müde. Warum rufe ich nicht um Hilfe, rufe zu Gott?
Weil Gott mir nicht helfen kann. Gott sucht mich, aber er kommt nicht heran an
mich. Gott ist ein anderer Hund in einem anderen Labyrinth. Ich rieche Gott,
und Gott riecht mich. Ich bin die läufige Hündin, und Gott das Männchen. Gott
riecht mich, er kann an nichts anderes denken, als mich zu finden und mich zu
nehmen. Hin und her springt er durch die Abzweigungen, kratzt am Maschendraht.
Aber er ist verloren, wie ich verloren bin.
Ich träume, aber ich
zweifele, daß es Gott ist, wovon ich träume. Wenn ich einschlafe, setzt eine
rastlose Bewegung von Gestalten hinter meinen Augenlidern
Weitere Kostenlose Bücher