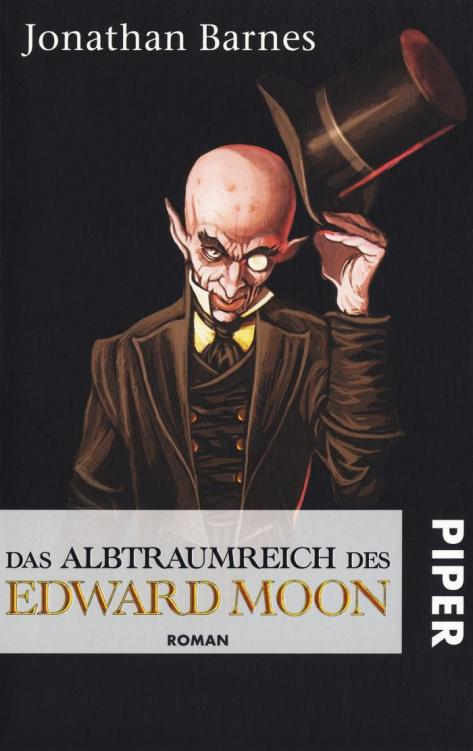![Das Albtraumreich des Edward Moon]()
Das Albtraumreich des Edward Moon
leichten
Reinigungsaufgaben beschäftigen.
Es ist mir ein Quell der Sorge, dass ich seit
ihrer Abreise nichts mehr von den Pantisokraten gehört oder gelesen habe.
Vergeblich habe ich die Zeitungen durchsucht und die Wärter und Ärzte gebeten,
auf jedes entsprechende Gerücht zu achten, das ihnen in der Welt draußen zu
Ohren kommt, aber bisher hat es den Anschein, als wären meine Jünger
verschwunden. Schade. Ich hätte sehr gern erfahren, wie schließlich alles
ausgegangen ist.
Als ich Edward Moon zum letzten Mal sah, hatte er
sich just an jenem Morgen von ihnen allen verabschiedet und war, gleich nachdem
er ihnen vom Kai aus nachgewunken hatte, stehenden Fußes zu mir gekommen. Ich
fragte ihn, ob Charlotte mich erwähnt hatte, und er verneinte umgehend und
nachdrücklich. Doch etwas an seinem Verhalten, verbunden mit der verdächtig
raschen Antwort, überzeugte mich, dass er log. Er verriet mir nur, dass es beim
Abschied wiederum Tränen und gegenseitige Beschuldigungen gegeben hatte. Es
war, wenn ich es recht verstanden habe, ein Abschied für immer.
Moon eröffnete mir, dass er vorhatte, auf Reisen
zu gehen. Zwischen uns hatte sich in all den Monaten unserer regelmäßigen
Gespräche ein gewisser Respekt entwickelt, der uns nunmehr in die Lage
versetzte, einander wie zivilisierte Menschen Adieu zu sagen und fast
freundschaftlich die Hände zu schütteln. Ich sagte ihm, dass ich plante, eine
vollständige Schilderung all dessen, was geschehen war, schriftlich niederzulegen,
worauf er antwortete, ich sollte genau das tun, wonach mir der Sinn stand.
Das Letzte, was ich von ihm hörte, war, dass er
sich nach Afrika begeben hatte, wo er ausgedehnte Reisen unternahm und
irgendwann so etwas wie einen Bund mit einem bestimmten Stamm von Eingeborenen
einging. Soweit mir bekannt ist, müsste er immer noch dort leben. Was mich
wieder an zwei Zeilen des Dichters denken lässt:
Und nichts mehr hörte man von ihm,
jedoch
Er lebte unter Wilden, bis er schließlich starb.
Ich habe jetzt sehr viel Zeit zur
Verfügung. Meine Gastgeber zeigen sich weiterhin entgegenkommend, und so
gestattete man mir einen Platz zum Schreiben mit ausreichend Licht, sowie eine
begrenzte Menge Kanzleipapier und einen einzigen Bleistift. Leider keine Feder –
ich habe schon des Öfteren um Tintenfass und Schreibfeder gebeten, doch es gibt
hier irgendeine lächerliche Vorschrift betreffend spitze und scharfe
Gegenstände. Man hält mich nicht ab von meiner Arbeit, obwohl man mir jeden
Abend alles zur sicheren Aufbewahrung abnimmt. Ich habe den Eindruck, dass
meine erzählerischen Fähigkeiten zusammen mit dem Fortschreiten der Geschichte
gewachsen sind, und bin daher etwas in Sorge, weil die ersten Abschnitte im
Vergleich zu späteren Kapiteln vermutlich dilettantisch und plump wirken. Ich
habe mich wiederholt erkundigt, ob man mir nicht erlauben könnte, das
vollständige Manuskript zur Überarbeitung oder für mögliche Klarstellungen in
die Hand zu bekommen. Doch bislang wurde mir diese Bitte stets abgeschlagen.
Zweifellos können Sie aus der
nüchternen Art und Weise dieses Berichts schließen, dass ich kein Mann bin, der
zu überbordender Phantasie neigt. Dennoch beunruhigt mich seit kurzem ein immer
wiederkehrender Traum.
Dieser gleicht jedoch nicht den üblichen
Träumen – kein Wirrwarr von aus großer Tiefe hervorgewühlten
Erinnerungsfragmenten und halb vergessenen Gesichtern, kein nichtssagendes
Kaleidoskop von unmöglichen Nebeneinanderstellungen oder Widersinnigkeiten. Und
auch die Einzelheiten des Traums verblassen am Morgen nicht, um allmählich ganz
zu verschwinden, sondern alles bleibt mir noch lange nach dem Aufwachen im
Gedächtnis und nimmt mit der Zeit eine solche Dauerhaftigkeit und Dichte an,
dass ich mich frage, ob das, was ich gesehen habe, nicht nur die Phantasie des
Schlafes ist, sondern ein Stück Wirklichkeit. Die Wahrheit.
Jedes Mal geschieht dasselbe. Es beginnt tief in
einem Wald. Alles Licht, das durch das Blätterdach der Bäume dringt, ist von
tiefem Grün, über den Köpfen kreischen fremdartige Vögel, und unsichtbare
Geschöpfe huschen durch den dichten Bewuchs am Boden. Ich sehe zwölf
Menschen – sechs Männer, sechs Frauen – sich durch den Wald
vorankämpfen. Sie müssen sich häufig den Weg durchs Unterholz freihacken, doch
sind sie wunderbarerweise stets bestrebt, paarweise zu gehen – in
Zweierreihen wie Schulkinder bei einem Ausflug in den Tiergarten. Einige von
ihnen erkenne ich:
Weitere Kostenlose Bücher