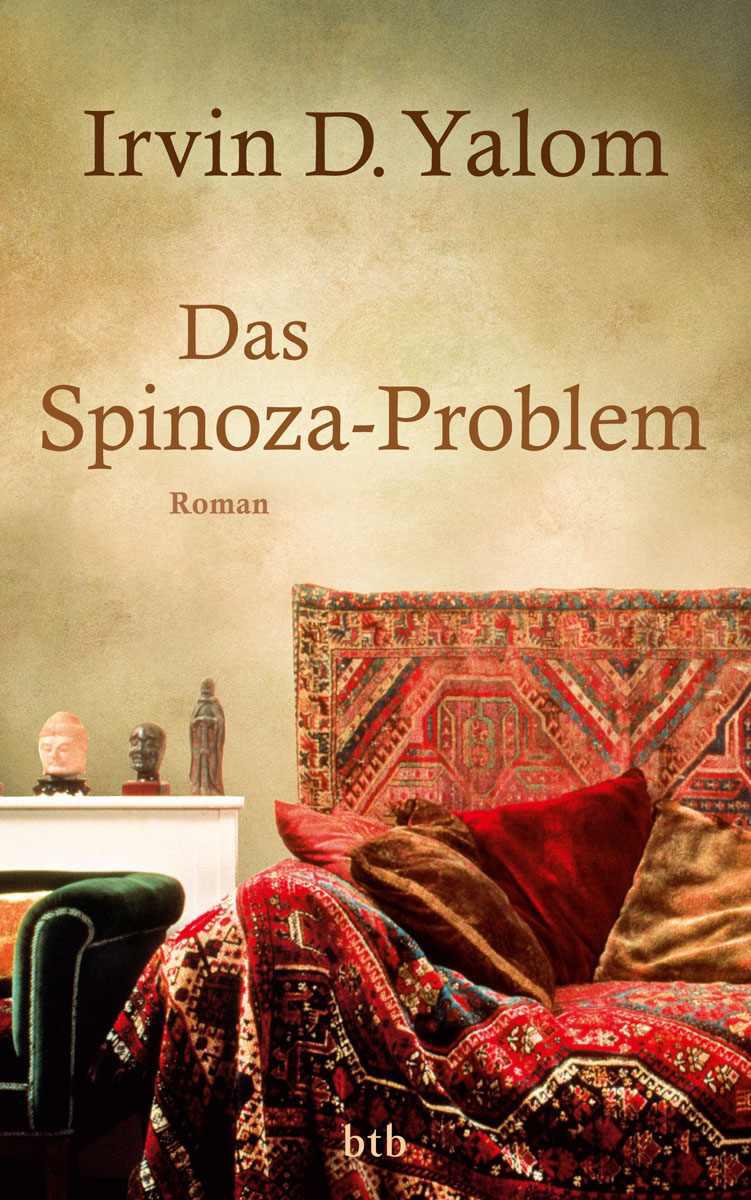![Das Spinoza-Problem: Roman (German Edition)]()
Das Spinoza-Problem: Roman (German Edition)
die Hälfte des Hauses ein Museum war und die andere Hälfte von einer Familie aus dem Dorf bewohnt wurde, die einen separaten Eingang an der Seite benutzte. Ein alter Pflug in der Einfahrt ließ darauf schließen, dass es sich vermutlich um Bauern handelte. Die Tür zum Museum war so niedrig, dass Alfred beim Eintreten den Kopf einziehen musste. Dann musste er bei einem schäbig gekleideten, jüdischen Aufseher eine Eintrittskarte kaufen, den er anscheinend bei einem Nickerchen gestört hatte. Der Aufseher war wirklich ein denkwürdiger Anblick! Er hatte sich offensichtlich seit Tagen nicht rasiert, und unter seinen verschlafenen Augen hingen dicke Tränensäcke.
Alfred war der einzige Besucher, und er sah sich enttäuscht um. Das ganze Museum bestand aus zwei kleinen, drei mal dreieinhalb Meter großen Räumen mit je einem kleinen Fenster, das nach hinten hinaus zu einem kleinen Obstgarten mit Apfelbäumen ging. Das eine Zimmer war von geringem Interesse: darin gab es gewöhnliches Schleifwerkzeug aus dem siebzehnten Jahrhundert; aber das andere, dasjenige, das Alfred in helle Begeisterung versetzte, beherbergte an einer Seitenwand Spinozas persönliche Bibliothek in einem etwa zwei Meter langen Bücherschrank mit Glastüren, die dringend geputzt werden sollten. Eine dicke, rote, von vier Stützen gehaltene Quastenkordel versperrte den Zugang zum Bücherregal. Auf den Regalbrettern standen voluminöse Bände dicht an dicht, die meisten aufrecht, nur die größeren waren waagerecht übereinander gestapelt. Alle waren mit strapazierfähigen Einbänden versehen und datierten aus dem siebzehnten Jahrhundert und noch davor. Hier lag ein wahrer Schatz. Alfred versuchte, die Bände zu zählen: weit über hundert. Der Aufseher, der auf einem Stuhl in der Ecke saß, spähte über seine Zeitung und rief: » Hondered een en vijftig .«
»Ich verstehe kein Holländisch. Ich spreche nur Deutsch und Russisch«, antwortete Alfred, woraufhin der Aufseher augenblicklich auf ein ausgezeichnetes Deutsch umschaltete – »hunderteinundfünfzig« – und sich wieder seiner Lektüre zuwandte.
An der angrenzenden Wand stand eine kleine Glasvitrine mit den ersten fünf Auflagen des Theologisch-Politischen Traktats – genau des Werks, das Alfred in seiner kleinen Tasche bei sich trug. Jede Ausgabe war auf der Titelseite aufgeschlagen, und wie die Legende auf Holländisch, Französisch, Englisch und Deutsch verriet, hatten die Verleger dieses Buch für so aufwieglerisch befunden, dass weder der Verfasser noch der Verlag erwähnt wurde. Darüberhinaus stand in jeder Ausgabe eine andere Stadt als Veröffentlichungsort.
Der Aufseher winkte Alfred an den Tisch und bat ihn, sich ins Gästebuch einzutragen. Nachdem Alfred unterschrieben hatte, blätterte er das Gästebuch durch und überflog die Namen der anderen Besucher. Der Aufseher streckte den Arm aus, blätterte ein paar Seiten zurück, deutete auf die Unterschrift Albert Einsteins (datiert vom zweiten November 1920) und bemerkte mit Stolz in der Stimme: »Nobelpreis für Physik. Ein berühmter Wissenschaftler. Er war fast einen ganzen Tag lang hier und hat in dieser Bibliothek gelesen. Und er verfasste auch ein Gedicht an Spinoza. Sehen Sie, dort drüben.« Er zeigte auf ein kleines, gerahmtes Blatt Papier, das hinter ihm an der Wand hing. »Es ist seine Handschrift – er hat es für uns kopiert. Das ist die erste Strophe seines Gedichts.«
»Wie lieb ich diesen edlen Mann
Mehr, als ich mit Worten sagen kann.
Doch fürcht’ ich, dass er bleibt allein
Mit seinem strahlenden Heiligenschein.«
Alfred kam die Galle hoch. Noch trivialer. Ein jüdischer Pseudowissenschaftler, der einen Mann, der selbst alles Jüdische von sich wies, mit einem jüdischen Heiligenschein versah. »Wer betreibt dieses Museum?«, fragte Alfred. »Die holländische Regierung?«
»Nein, es ist ein privates Museum.«
»Von wem gesponsert? Wer bezahlt das?«
»Die Spinoza-Gesellschaft. Freimaurer. Private jüdische Spender. Dieser Mann hier hat das Haus und das meiste in der Bibliothek bezahlt« – der Aufseher blätterte in dem dicken Gästebuch an den Anfang zurück und zeigte auf die erste Unterschrift aus dem Jahr 1899: George Rosenthal.
»Aber Spinoza war kein Jude. Die Juden haben ihn exkommuniziert.«
»Einmal Jude, immer Jude. Warum stellen Sie eigentlich so viele Fragen?«
»Ich bin Schriftsteller und Hauptschriftleiter einer Zeitung in Deutschland.«
Der Aufseher beugte sich über das Buch und
Weitere Kostenlose Bücher