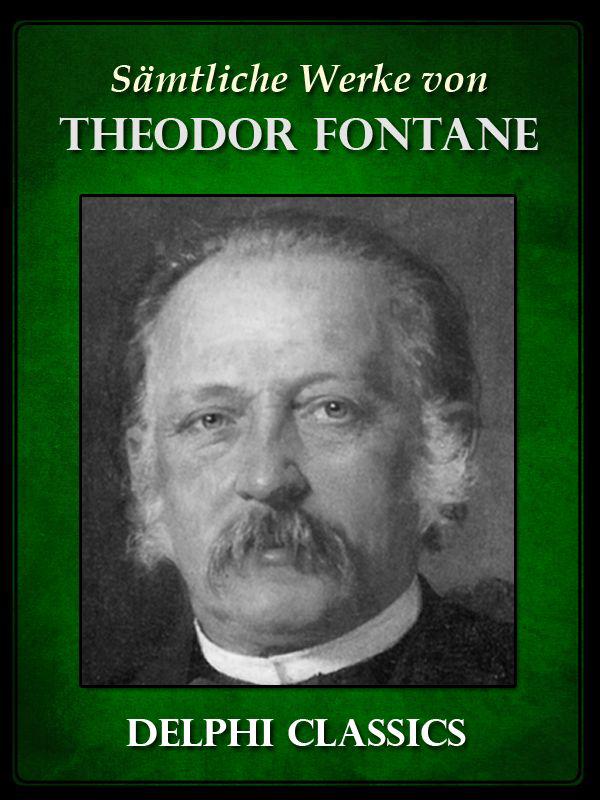![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
der Kastellanin – auch tot; endlich erschien ein Mann mit einem großen alten Schlüssel, der mir als der Herr »Exekutor« vorgestellt wurde. Dies ängstigte mich ein wenig. Es war ein ziemlich mürrischer Alter, der von nichts wußte, vielleicht auch nichts wissen wollte .
Wir traten durch eine Seitentür auf den Schloßhof. Es war schon heiß, trotz der frühen Stunde; die Sonne schien blendend hell, und die Bosquets samt der weißen Pumpe waren nicht ganz mehr, was sie den Abend vorher gewesen waren.
Wir umschritten zunächst das Schloß, dann nahm ich einen guten Stand, um mir die Architektur desselben einzuprägen. Es ist gewiß ein ziemlich häßliches Gebäude, aber doch noch mehr originell als häßlich und in seiner Apartheit nicht ohne Interesse. Der ganze Bau, bis zu beträchtlicher Höhe, ist aus Feldstein aufgeführt woraus ich den Schluß ziehe, daß der König die dem vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhundert angehörige Grundform des Schlosses: ein Viereck mit vorspringendem Rundturm, einfach beibehielt und nur die Gliederung und Einrichtung völlig veränderte. Der Rundturm wurde Treppenturm. Von diesem aus zog er eine Mauerlinie mitten durch das Feldsteinviereck hindurch und teilte dadurch den Bau in zwei gleiche Hälften. Jede Hälfte erhielt ein Giebeldach, so daß wer sich dem Schlosse jetzt nähert, zwei Häuser zu sehen glaubt, die mit ihren Giebeln auf die Straße blicken. In Front beider Giebel und an beide sich lehnend steht der Turm.
Dieser Turm ist sehr alt; König Friedrich Wilhelm I. aber hat ihm einen modernen Eingang gegeben, ein Portal in Mannshöhe, dessen Giebelfeld etwa ein Dutzend in Holz geschnittene Amoretten zeigt. Einige sind wurmstichig geworden, andere haben sonstigen Schaden genommen.
Beim Eintreten erblickt man zuerst ein paar verliesartige Kellerräume, darin etwas Stroh liegt, als wären es eben verlassene Lagerstätten. Von hier aus führt eine Treppe von zehn oder zwölf Stufen ins Hochparterre, danach eine zweite, höhere Treppe bis ins erste Stockwerk. Wir verweilen hier einen Augenblick. Ein schmaler Gang scheidet zwei Reihen Zimmer voneinander, deren Türen, etwa in Mittelhöhe (mutmaßlich des besseren Luftzugs halber), kleine Gitterfenster haben, infolgedessen die Zimmer aussehen wie Gefängniszellen. Es sind dies ersichtlich dieselben Räume, darin die Prinzessinnen schlafen mußten, wenn sie nicht in den kleinen Giebelstuben untergebracht wurden. Die Gitterfenster gönnen überall einen Einblick. In einem der Zimmer lagen Aktenbündel ausgebreitet, weiße, grüne, blaue, wohl achtzig oder hundert an der Zahl. Mutmaßlich eine alte Registratur der Herrschaft Königs Wusterhausen.
Wir stiegen nun ins Hochparterre zurück. Hier befindet sich die ganze Herrlichkeit des Schlosses auf engstem Raum zusammen. Man tritt zuerst in eine mit Hirschgeweihen ausgeschmückte Jagdhalle, die, wie der Flurgang oben, zwischen zwei Reihen Zimmern hinläuft. Die frühere große Sehenswürdigkeit darin ist derselben verlorengegangen. Es war dies das 532 Pfund schwere Geweih eines Riesenhirsches, der 1636, also zur Regierungszeit George Wilhelms, in der Köpnicker Forst, vier Meilen von Fürstenwalde, erlegt worden war. Über dies Geweih ist auch in neuerer Zeit noch viel gestritten und obige Gewichtsangabe, wie billig, belächelt worden. Nichtsdestoweniger muß das Geweih etwas ganz Enormes gewesen sein, da Friedrich August II. von Sachsen dem Könige Friedrich Wilhelm I. eine ganze Compagnie langer Grenadiere zum Tausch dafür anbot, ein Anerbieten, das natürlich angenommen wurde. Das Geweih existiert noch und soll sich auf dem Jagdschloß Moritzburg bei Dresden befinden.
Rechts von der Halle sind zwei Türen. An der einen, zunächst der Treppe, standen mit Kreide die Worte: »Wachtstube der Artillerie«. Bei Manövern, Mobilmachungen etc. muß nämlich das Wusterhausener Schloß wohl oder übel mit aushelfen und erhält vorübergehend eine kleine Garnison. Auch stehen in der Tat die meisten dieser Räume, wenigstens in der Gestalt in der ich sie noch sah, auf der Stufe von Kasernenstuben.
Das erste Zimmer hinter der mit Kreide beschriebenen Tür war ehedem das Schlafzimmer Friedrich Wilhelms I. Es befindet sich in demselben das große Waschbecken des Königs, etwas höchst Primitives, eine Art festgemauertes Waschfaß . Aus Gips gefertigt, gleicht es den Abgußsteinen, die man in unseren Küchen findet und hat in der Tat eine Öffnung zum Abfluß des Wassers, in
Weitere Kostenlose Bücher