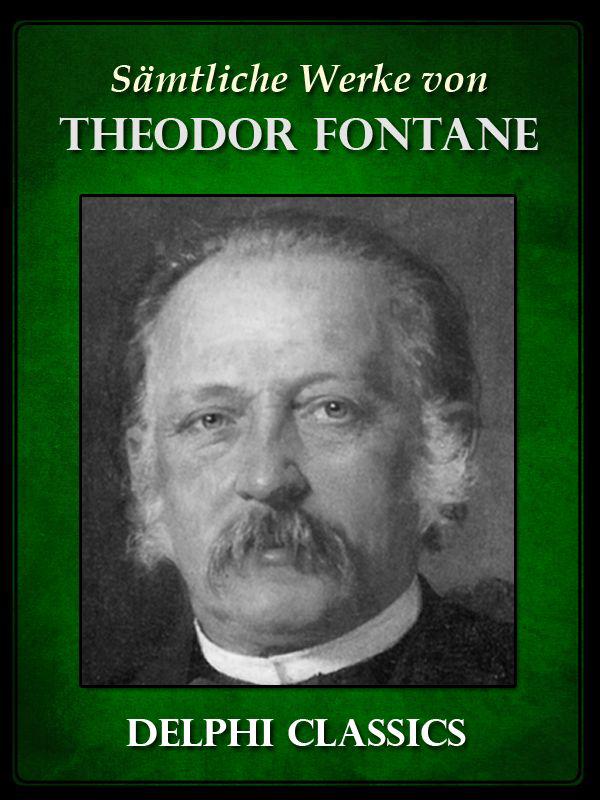![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
dies Denkmal Tauentziens« – so schreibt er selbst – »nicht zu den Kunstwerken gezählt werden, die als Vorbilder dienen dürfen«, und über die Statue Friedrichs II. in Stettin, die von vielen Seiten seinen besten Arbeiten zugezählt und über das Rauchsche Kolossalwerk gestellt worden ist, läßt er sich selber in abwehrender Weise vernehmen: »Ich zähl auch diese Arbeit nicht zu den gelungenen; die Drapierung des Mantels war ein mühseliges Unternehmen.« Von den Reliefs am Berliner Münzgebäude sagt er in heiterer Anspruchslosigkeit: »Wer diese Arbeiten als meine besten gepriesen hat, mag es vor sich und vor der Welt verantworten.«
Solcher Aussprüche finden sich viele. Eine ungeheure Produktionskraft und eine bis ins späte Alter hinein dem entsprechende Leichtigkeit des Schaffens machten ihn gleichgültig dagegen, ob das ein’ oder andre seiner Werke verlorenging oder nicht. Immer das Ganze vor Augen, war er nicht ängstlich bei jedem einzelnen auf Ruhm und Unsterblichkeit bedacht, auch wenn das einzelne wirklichen Wert besaß. Eine kleine Anekdote mag das zeigen. Unter den vielen Statuetten, die in seinem Zimmer auf Konsolen und Simsen umherstanden, befanden sich auch die Modellfiguren zweier Grazien, die er in grüner Wachsmasse ausgeführt hatte. Es waren Arbeiten aus seiner besten Zeit, kleine Meisterwerke, die mehr als einmal die Bewunderung eintretender Künstler und Kenner erregt hatten. Durch eine Unvorsichtigkeit indes waren während des Winters 1840 beide Figuren in die Nähe des Ofens gestellt worden und hatten, weil das Wachs an der Oberfläche schmolz, eine wie mit Pickeln übersäte Haut bekommen. Ein Tausendkünstler aus der Schadowschen Bekanntschaft erbot sich, mit Hülfe von Naphtha oder Äther die alte normale Schönheit wiederherzustellen. »Na, na«, hatte der Alte kopfschüttelnd abgewehrt, sich aber schließlich doch bestimmen lassen. Leider sehr zur Unzeit, und in einem Zustande merkwürdiger Schlankheit kehrten nach kaum acht Tagen die Äthergebadeten in das Schadowsche Haus zurück. Der Alte ging einen Augenblick musternd und schmunzelnd um seine Lieblingsgestalten herum und sagte dann ruhig zu dem erwartungsvoll Dastehenden: »Ja, de Pickeln sind weg, aber de Pelle ooch.« Wenige hätten gleich ihm die Beherrschung gehabt, mit einer humoristischen Bemerkung von einer so wertvollen und allgemein als mustergiltig angesehenen Arbeit Abschied zu nehmen.
Ein solches, von einem leichten Humor getragenes Abschiednehmen war nun freilich nicht immer seine Sache. Mußt es sein, wie in dem vorerzählten Falle, so fand er sich darin; aber freiwillig – nein. Auch hierfür ein Beispiel.
Einer seiner Schüler, der spätere Professor F., hatte sich durch Ausführung einer ihm im Interesse Schadows übertragenen Arbeit die ganz besondere Zufriedenheit des Alten erworben, so daß dieser in guter Laune sagte: »Nu höre, F., nu könntest du dir woll eigentlich sozusagen ne Gnade bei mir ausbitten. Na, sage mal, was möchtst du denn woll.«
»Ja, Herr Direktor…«
»Na, geniere dir nich. Sage man janz dreiste…«
»Ja, Herr Direktor, wenn Sie denn wirklich so viel Güte für mich haben wollen, dann möcht ich Sie wohl um die beiden kleinen Modellfiguren bitten, die da oben stehen.«
»Um welche denn?«
»Um den alten Dessauer und den alten Zieten.«
»I süh!… Höre, F., du bist nich dumm. Aber ich werde dir doch lieber fünfundzwanzig Daler geben.«
Und so geschah es.
Er war auch ein Repräsentant der Berliner Ironie, der trostlosesten aller Blüten, die der Geist dieser Landesteile je getrieben hat. Aber er war ein Repräsentant derselben auf seine Weise. Man hat, wenn solche Abschweifung an dieser Stelle gestattet ist, dies ironische Wesen auf den märkischen Sand, auf die Dürre des Bodens, auf den Voltairianismus König Friedrichs II. oder auch auf die eigentümliche Mischung der ursprünglichen Berliner Bevölkerung mit französischen und jüdischen Elementen zurückführen wollen – aber, wie ich glaube, mit Unrecht. Alles das mag eine bestimmte Form geschaffen haben, nicht die Sache selbst . Die Sache selbst war Notwehr, eine natürliche Folge davon, daß einer Ansammlung bedeutender geistiger Kräfte die großen Schauplätze des öffentlichen Lebens über Gebühr verschlossen blieben. Das freie Wort ist endlich der Tod der Ironie geworden und wird es täglich mehr. Zu Schadows Zeiten aber blühte sie noch, und da es für den einzelnen immer mehr oder weniger
Weitere Kostenlose Bücher