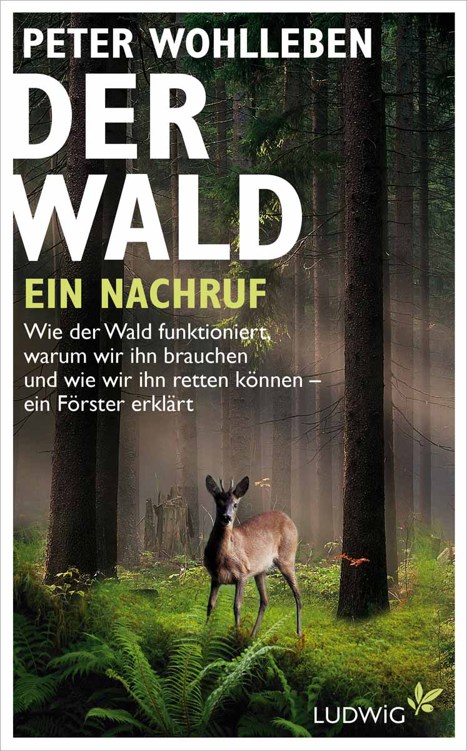![Der Wald - ein Nachruf]()
Der Wald - ein Nachruf
der Frühlingstraum. Bis zu 1,5 Kilogramm kann ein zartes Reh davon täglich vertilgen. Und weil es zu faul ist, sich herunterzubeugen, wird meist nur die Gipfelknospe verspeist. Für das Bäumchen ist das fatal, denn um nun weiter in die Höhe zu wachsen, muss ein Seitentrieb die Führung übernehmen. Aber dafür ist er im Grunde gar nicht geeignet, weshalb solche Bäume zeitlebens krumm und schief wachsen. Nun wären ein paar gebogene Exemplare kein Beinbruch. Das Millionenheer der Jungbuchen verkraftet den einen oder anderen Ausfall, denn das ist ja der Grund, warum sie so zahlreich sind. Wie viele Bäumchen so ein Reh pro Tag schädigt, wird deutlich, wenn man das Gewicht der Knospen kennt. Es sind zehn Stück, die ein Gramm ergeben. Pro Tag verschwinden demnach bis zu 15 000 Triebspitzen im Magen eines einzigen kleinen Wiederkäuers. Bei natürlichen Wilddichten, also einem Reh pro Quadratkilometer, verkraftet dies der Wald. Wandern aber 50 bis 100 Tiere durchs Gehölz, so hat der Baumnachwuchs keine Chance mehr. Jede Jungbuche wird entdeckt und angefressen, bis schließlich nur noch ein verkrüppelter Kindergarten übrig bleibt.
Die Forstwirtschaft trägt ihren Teil dazu bei, das Dilemma noch zu verschärfen. Von Natur aus herrscht in einem alten Buchenwald ständiges Dämmerlicht, in dem die Sämlinge extrem langsam wachsen. Dadurch sind auch ihre Knospen sehr klein und vergleichsweise nährstoffarm. Aufgrund der geringen Fotosynthese, die die jungen Bäume am Fuß der Elternbäume betreiben können, enthalten die Knospen kaum Zucker. Sie schmecken bitter und sind für Rehe daher nicht so interessant wie die Sträucher am Waldrand. Diese stehen in der prallen Sonne, tanken viel Energie und werden so süß und saftig. Wird ein alter Buchenwald aber ständig durchforstet, gelangt auch hier viel Licht auf den Bo den, wodurch die Jungbuchen schneller wachsen. Sie produzieren mehr Zucker, bilden im Herbst dickere Knospen und sind nun als Rehmahlzeit wesentlich attraktiver. Denn die Rehe bleiben als Wildtiere lieber im tiefen Wald, geschützt und gut versorgt durch solche Angebote.
Für die alten Buchen ist das eine Katastrophe. Alle paar Jahre mühen sie sich ab und produzieren überreichlich Eckern, die das Überleben der Familie sicherstellen sollen. Stattdessen enden diese als Futter in den Mägen der Pflanzenfresser. Und das Drama beginnt nicht erst mit den Sämlingen, sondern schon mit dem herbstlichen Fall der Früchte vom Baum. Nun kommen die Wildschweine, die den Boden zerwühlen, um auch ja keinen Samen zu übersehen. Ihren empfindlichen Nasen entgeht kaum etwas und auch hier ist nicht das einzelne Tier, sondern ihre unnatürlich hohe Zahl das Problem. Wo wenige Exemplare noch genügend Eckern für das nächste Frühjahr übrig lassen, bedeutet der mehrfache Besuch großer Rotten verwaiste, umgewühlte Erde. Und die paar Sämlinge, die das Ganze überleben, werden oft mit Austriebsbeginn im Mai von Rehen und Hirschen vertilgt.
Als Resultat tritt ein Überweidungseffekt auf, ähnlich einer Viehweide mit zu hohem Besatz. Dort fressen die Kühe so lange alles schmackhafte Gras und alle saftigen Kräuter, bis nur noch dorniges oder giftiges Grünzeug übrig bleibt. Brennnesseln, Disteln oder Schlehen überziehen dann im Lauf der Zeit die einst artenreiche Fläche.
Im Wald ist es nicht anders. Von Natur aus sind Laubbäume, speziell Buchen, die konkurrenzstärksten Pflanzen Mitteleuro pas. Ließen wir unsere Finger aus dem Spiel, würde innerhalb weniger Jahrzehnte jeder Quadratmeter von ihnen erobert, Gewässer und Moore einmal ausgenommen. Gräser und Kräuter, Stauden und Sträucher, sie alle hätten keine Chance und wüchsen lediglich an Flussufern, der Küste oder im Hochgebirge. Diese Überlegenheit wird durch den Wildfraß zerstört. Die Laubbaumjugend bekommt ständig einen Dämpfer und wird wieder und wieder zurückgebissen, bis sie zu bonsaiartigen Krüppeln mutiert. Dass diese Büsche, kaum 30 Zentimeter hoch, eigentlich stolze Urwaldriesen werden sollten, sieht man ihnen auch nach Jahr zehnten nicht an. Ihre Konkurrenten, die übrige Pflanzenwelt, weiß die Chance bestens zu nutzen. Gras, von Natur aus im Wald sehr selten zu finden, breitet sich teppichartig unter den verbliebenen Altbäumen aus. Sein Siegeszug wird durch die Forstwirtschaft stark begünstigt, denn überall dort, wo Bäume gefällt werden, kommt viel Licht auf den Boden und schafft gute Wachstumsbedingungen für diese und andere
Weitere Kostenlose Bücher