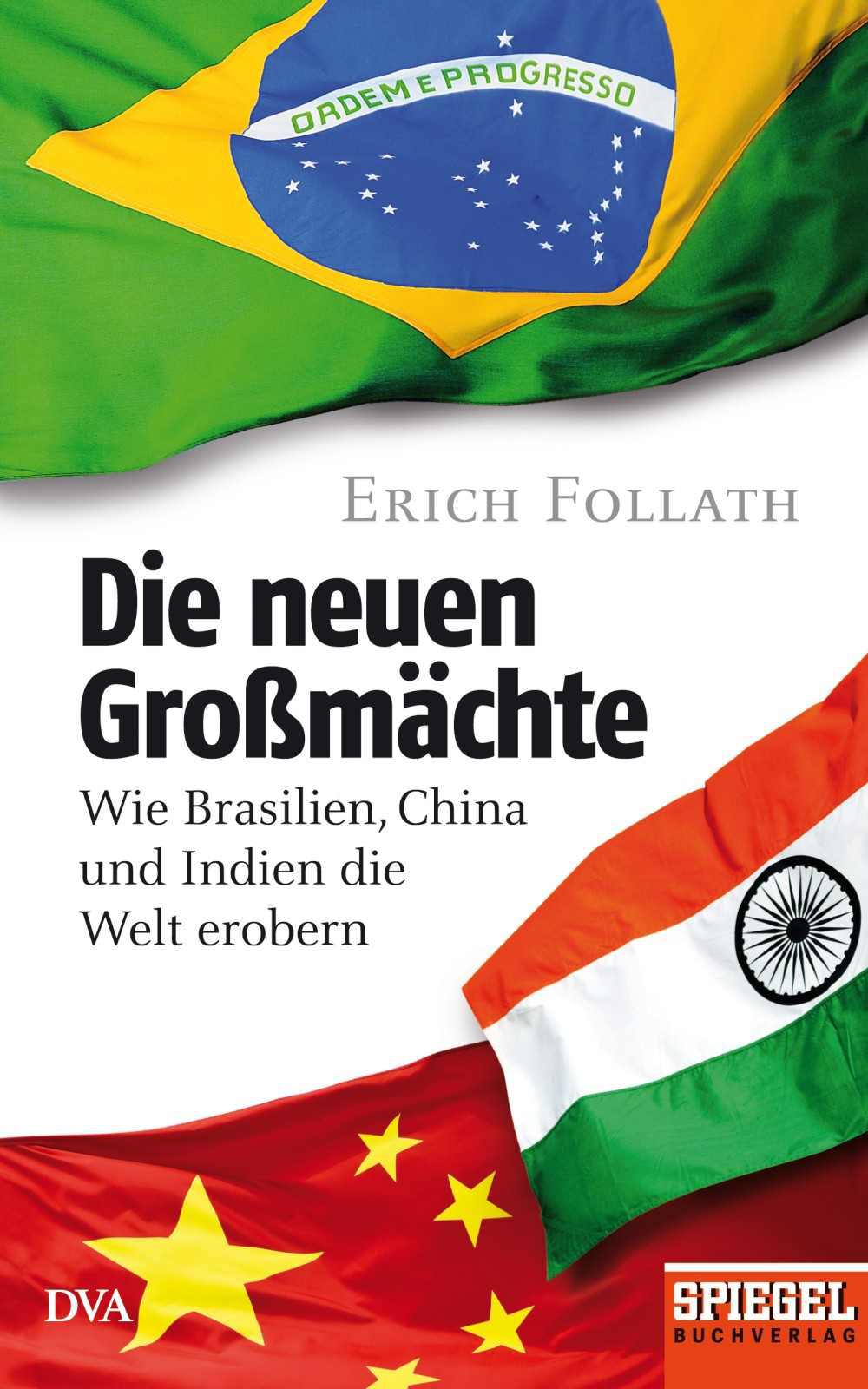![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
eine arme, unterentwickelte Nation nach vorn zu katapultieren. Er eignet sich nicht, um ein zunehmend reiches und industrialisiertes Land weiterzuentwickeln. Ein grundlegender Mangel des bisherigen Modells liegt darin, dass die Bürokraten den Geldfluss manipulieren und die entscheidenden Preise festlegen – die Zinsrate etwa oder den Außenwert der Währung – und nach Gutdünken billiges Geld in die Wirtschaft pumpen. Das mag kurzfristig eine notwendige und richtige Entscheidung sein. Aber grundsätzlich werden so auch Staatsbetriebe am Leben gehalten, die längst hätten bankrottgehen müssen. Private Haushalte horten Geld, statt Konsum im Land zu stützen, ein bisher nur mangelndes Gesundheits- und Pensionssystem zwingt sie zur Vorsicht.
Unter der Hand geben manche Funktionäre diese Mängel zu. Sie verweisen darauf, dass ja schon manches geschehen sei, ein Großteil der Bevölkerung erhalte inzwischen immerhin 50 Prozent der Arztrechnungen erstattet, eine Mehrheit in den Städten könne auch mit einer Rente rechnen. Es existierten inzwischen Zehntausende Anwälte, die man bei Beschwerden gegen die Staatsgewalt anlaufen könne, lokale Demonstrationen würden in der Regel nicht mehr niedergeschlagen, eine Zivilgesellschaft sei im Entstehen. Aber die Ehrlicheren unter ihnen geben zu, dass es bei allen Bemühungen bis zu demokratischen Grundrechten und einer einigermaßen befriedigenden Grundversorgung der Bevölkerung noch ein langer, steiniger Weg ist. Immer noch muss in China jeder Vierte mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. Andererseits wird das Land schon im Jahr 2015 der größte Markt für Luxusgüter weltweit sein.
Nur wenige chinesische Politiker wagen es, sich offen auf die liberale Seite zu stellen – ihre größte Hoffnung heißt Wang Yang, der bis vor Kurzem Parteichef der Provinz Guangdong war und jetzt zu einem der vier Vizepremiers aufgestiegen ist. Der Mittfünfziger fordert, Chinas Ökonomie mehr in Richtung Privatwirtschaft zu öffnen. Er will dafür durchaus unkonventionell und auch personell mutig vorgehen, in seinen Worten: »den Käfig leeren und die Vögel austauschen«. Wang will weg von einer rein exportgetriebenen Wirtschaft und plant dazu, den innerchinesischen Konsum anzukurbeln (was im ersten Quartal 2013 immerhin erste Erfolge zeigte, mehr als die Hälfte des Wachstums beruht nunmehr auf consumer spending ). Er hat in den Fünfjahresplan seiner Provinz ganz amerikanisch das Streben nach Glück aufgenommen, einige Bürgerproteste im Sinne der Demonstranten geschlichtet. Er befürwortet auf Kreisebene Wahlen zwischen Kandidaten unterschiedlicher Couleur, auch von Nicht-Parteimitgliedern. Ob solche Entwicklungen eines Tages auch das Monopol der KP beenden könnten, dazu schweigt der tatkräftige Herr Wang – wegen seines Wuchses und seiner schnarrenden Befehlsstimme »Kleiner Marschall« genannt – allerdings eisern. Wer sich zu weit vorwagt, das weiß der Reformer, kann seine Aufstiegschancen gefährden, möglicherweise auch ganz ins politische Abseits geraten. Wang Yang verkörpert das Gegenprogramm zu Bo Xilai, dem Ex-Parteiboss von Chongqing, der mehr Staat und eine Wiederbelebung des Marxismus-Maoismus gefordert hatte. Wang war ironischerweise der Vorgänger des heute Verfemten in der Provinz Chongqing.
Und irgendwo in der Mitte steht die neue Nummer eins, der »Führer der unfreien Welt« ( Time ), der mächtigste Mann auf unserem Planeten neben Barack Obama. Xi Jinping, der neue und doch schon so erfahrene KP -Chef und Staatspräsident, hat noch nicht erkennen lassen, welche Risiken er eingehen, wie entschieden er einen Reformprozess einleiten will. Dass er sich mit seinem unprätentiösen Stil von seinen Vorgängern unterscheidet und den Funktionären Genügsamkeit und Kampf gegen die Korruption verordnet hat, macht noch keine »Xi-Doktrin«. Immerhin hat er im Frühjahr 2013 die Zahl der Kabinettsposten verkleinert, das Eisenbahnministerium abgeschafft und so gezeigt, dass er bei der Beschneidung der Bürokratie auch unbequeme Schritte wagt. Auf jeden Fall ist für ihn und seine Spitzengenossen – die vierte Generation nach Mao – das Durchregieren schwer geworden. Heute haben selbst gut ausgebildete junge Chinesen keine Garantie mehr, einen lukrativen Job zu finden. Sie können somit auch nicht ihren Eltern, die ihnen unter persönlichen Entbehrungen das Studium ermöglicht haben, den Lebensabend sichern. Die 200 Millionen Wanderarbeiter im Land, lange Zeit
Weitere Kostenlose Bücher