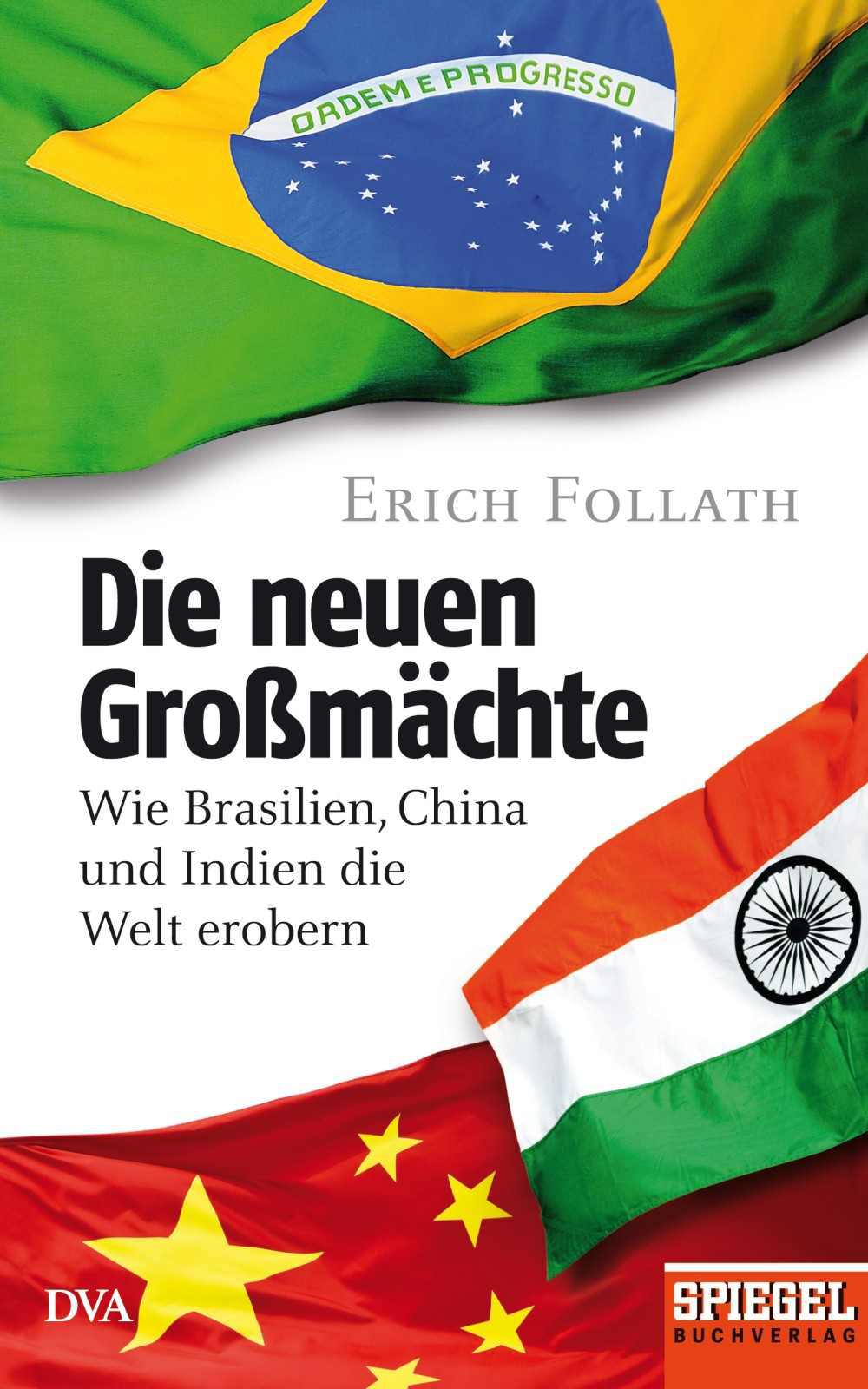![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
seiner Entlassung aus dem Gefängnis in einem öffentlichen Park Unkraut gejätet, bevor ihm jetzt eine Position als »Historiker« zugewiesen worden war. Er verfügte über eine Hausangestellte und einen Koch, sogar einen Dienstwagen. Wir gingen dann aber zu Fuß in sein ehemaliges Reich, schlenderten durch den Palastbezirk. Er kaufte sich an einem Stand ein Eis, keiner erkannte Pu Jie, den kaiserlichen Spross im schlichten Mao-Anzug. »Hier auf dem Marmor sind mein Bruder und ich Fahrrad gefahren. Da hinten waren die Quartiere der Eunuchen, Mann, haben wir die immer geärgert. Fresst den Dreck, sagte mein Bruder, dieses verzogene und arrogante Kind, wenn er schlechte Laune hatte, und dann mussten sie die Blumenerde hinunterwürgen und sich noch für die Gunst bedanken.« Dann schlenderten wir wieder zurück. Mit schwungvoller Schrift widmete mir Pu Jie sein Buch und drückte den Familienstempel hinein. Ein ganz und gar ungewöhnlicher Parteigenosse, der später sogar Abgeordneter im Volkskongress wurde und Bernardo Bertolucci 1987 bei der Verfilmung von Der letzte Kaiser als »wissenschaftlicher Ratgeber« zur Seite stehen durfte. 1994 starb er.
Sun Yaoting erinnerte sich bei unserem Treffen an Pu Yi und Pu Jie, die »Horrorkinder«, wie er sie nannte. »Ich weiß gar nicht mehr, wer schlimmer war«, sagt er mit dieser charakteristisch hohen Fistelstimme, die sozusagen als seine »Berufskrankheit« galt. Sun war bei meinem Interview Anfang der Achtzigerjahre der letzte noch lebende Eunuch. Einer von der anderen Seite des Palasts, kein Herrschender, ein Dienender der Kaiserzeit. »Es war eine Zeit der Demütigungen«, sagte mir der gebrechliche Greis. »Ich sah überall in der Verbotenen Stadt Vorzeichen des Verfalls. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich das Ende der Welt näherte.« Er war als Knabe von acht Jahren durch den eigenen Vater in den Kreis der Entmannten befördert worden – damals eine der ganz wenigen Möglichkeiten für die Kinder armer Leute, Karriere zu machen, und die einzige, an den Hof zu kommen. Eunuch zu werden galt als schändlich, und doch wählten aus Verzweiflung viele diese Variante. Es gab ein Überangebot, und Sun konnte von Glück sagen, dass er dann mit 15 Jahren in die »Verbotene Stadt« berufen wurde. Eunuchen banden dem Kaiser die Schuhe und schleppten bei dessen Ausflügen den Nachttopf hinterher. Sie schrubbten Böden, hüteten Schätze, fütterten Haustiere, lasen Geschichten vor und verbrannten Weihrauch. 1924 wurden die Eunuchen gemeinsam mit der kaiserlichen Familie aus dem Palast gejagt. Sun und seine Kollegen kamen in eine Welt, in der sie keine Rolle und keinen Platz hatten. Sie wurden herumgestoßen und gehänselt, gingen betteln, versteckten sich in Tempeln. Das blieb so bis zum Sieg der Revolution: Mao ließ die dreißig noch lebenden Eunuchen sozusagen unter Denkmalschutz stellen.
Auch mit Sun bin ich durch die alten Paläste gewandert. Fasziniert schaute er, wie gewöhnliche Sterbliche jetzt in den kaiserlichen Gärten Picknick machten, wie Kinder auf den kaiserlichen Höfen spielten, wie Soldaten der Volksbefreiungsarmee für Fotos posierten. »Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass die keiner vertreibt«, sagte er. Sun Yaoting hat dann noch bis 1994 gelebt, wurde weit über neunzig Jahre alt. Ein kleiner, finaler Triumph: Er hat den letzten Kaiser und dessen Bruder überlebt, und übrigens auch Mao Zedong, den sie den »neuen Kaiser« nannten.
Wenn ich in diesen Tagen durch Peking gehe und das Leben dort mit den Verhältnissen vor vierzig Jahren vergleiche, fällt mir vor allem der Fortschritt auf. Der Reichtum der Stadt mit ihren Boutiquen, Einkaufszentren, Cafés. Fast alle meine früheren Freunde haben Karriere gemacht, einige sind sehr reich geworden, die meisten aufgestiegen in die neue Mittelklasse. Sie können sich etwas leisten, und sie genießen das auch. Früher haben sie sich darüber beschwert, dass ihnen im Privatleben die Luft zum Atmen abgeschnürt werde und sie sich an idiotischen politischen Kampagnen wie dem Kampf gegen Spatzen beteiligen mussten (Siebzigerjahre); dass es kaum irgendwo Nutella, Bananen oder Coca-Cola gab (Achtzigerjahre); dass ihre alten Häuser ohne nennenswerte Entschädigung Wolkenkratzern weichen mussten (Neunzigerjahre); dass die Nummernschilder für die Autos von korrupten Beamten unter der Hand versteigert wurden (Nullerjahre). Heute stehen ganz andere Dinge im Vordergrund, und sie betreffen nicht mehr so
Weitere Kostenlose Bücher