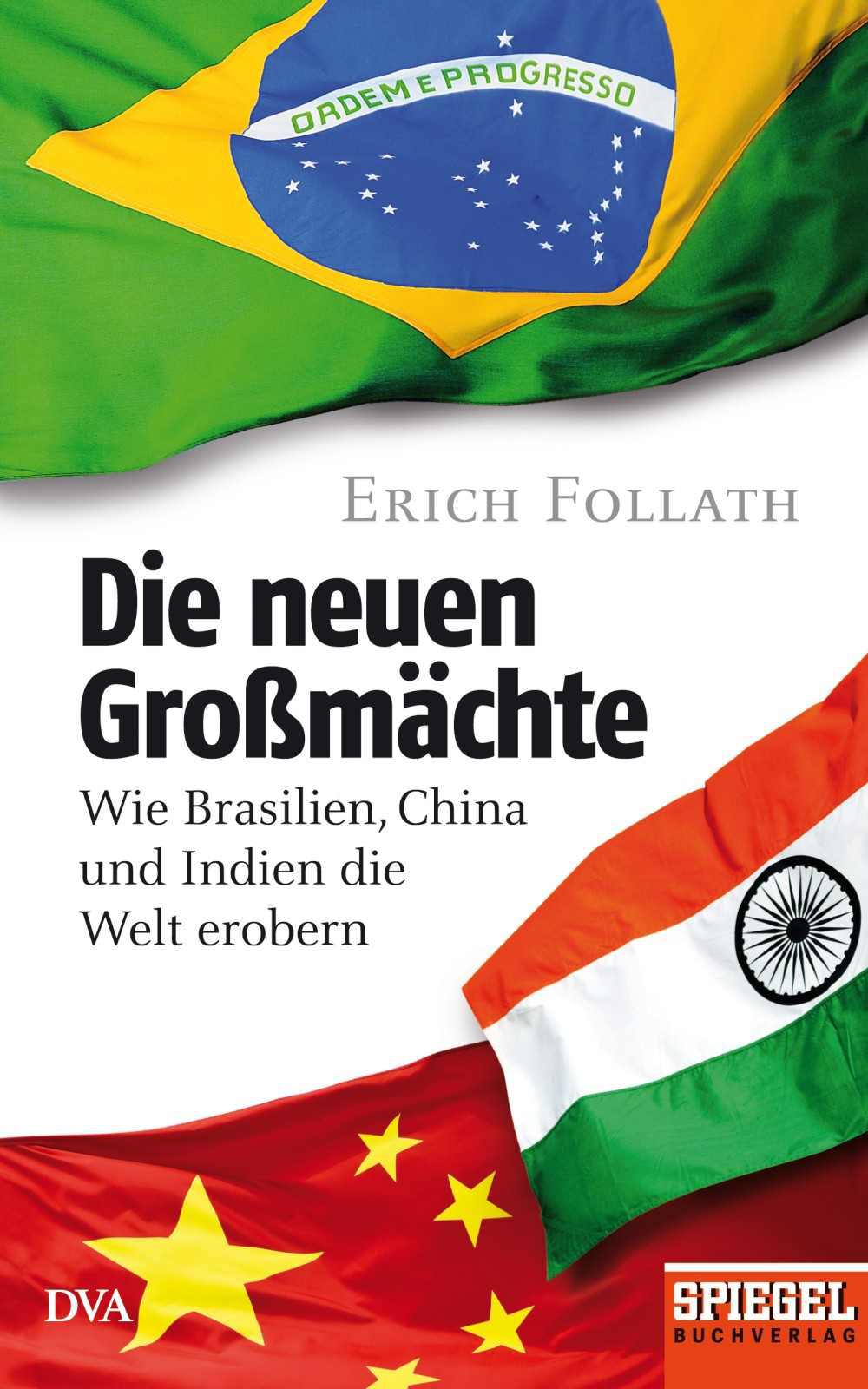![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
deutsche Unternehmen besonders in den weltweiten Rezessionsjahren 2008 und 2009 zum Rettungsanker wurde. Dank der massiven staatlichen Konjunkturhilfe blieb China flüssig, Chemieunternehmen wie BASF und vor allem die Autokonzerne VW , BMW und Daimler steigerten sogar ihren Absatz; längst schon werden im Reich der Mitte mehr Volkswagen verkauft als in der Heimat. Aber der Erfolg hat seinen Preis. Peking verlangt von ausländischen Firmen, dass sie vor Ort produzieren, ihr Know-how mitbringen und sich mit einheimischen Partnern zusammenschließen. Und sehr oft wird dieses Hightech-Wissen dann in eigene chinesische Firmen »eingespeist«: Züge, Autos, Werkzeugmaschinen gleichen inzwischen häufig den Ursprungsprodukten wie ein Ei dem andern. Zuletzt soll die Firma FAW in Changchun sogar ein komplettes VW-Getriebe nachgebaut haben. Aus Partnern können so gefährliche Konkurrenten werden – und das schafft böses Blut.
Ein mindestens ebenso großes Problem für westliche Unternehmen ist das chinesische Dumping: Der Staat fördert einzelne zukunftsträchtige Branchen so massiv mit Cash und Krediten, dass diese mit Niedrigstpreisen auf dem Weltmarkt alle verdrängen können. So geschehen etwa im Bereich Solarzellen. Vor zehn Jahren produzierten die USA noch 27 Prozent solcher Module, die Chinesen ein Prozent. Jetzt liegt der Weltmarktanteil der Amerikaner gerade noch bei 3 Prozent, aus der Volksrepublik stammen etwa 65 Prozent. Und auch dort bekriegen sich die Unternehmen in einem ruinösen Wettbewerb, wahrscheinlich wird die Partei nur drei oder vier große übriglassen. Washington verhängte Sonderzölle, Peking schlug mit eigenen Strafzahlungen gegen US -Produkte in anderen Branchen zurück – ein Handelskrieg auf Sparflamme, der sich jederzeit ausweiten könnte. Auch die lange Zeit so erfolgreichen deutschen Solarfirmen kamen wegen der fernöstlichen Schleuderpreise unter die Räder. Tausende Arbeitskräfte gingen verloren. Aber Kanzlerin Angela Merkel mied bei ihrem Peking-Besuch im August 2012 – dem zweiten innerhalb eines Jahres, begleitet vom halben Kabinett – jede scharfe Kritik an dem Handelspartner, bei Wirtschaftsproblemen wie auch bei Menschenrechtsfragen. Man solle den Solarstreit durch Verhandlungen lösen, schlug sie vor, und wie so häufig zeigte sich auch die mitgereiste große Delegation von Wirtschaftsführern zaghaft und zahm.
Bald wurde klar, wie isoliert die Kanzlerin mit ihrem Kuschelkurs ist. Sebastian Bersick, Professor für Internationale Beziehungen an der Schanghaier Fudan-Universität, meint: »Es wäre nicht klug, wenn Deutschland seine bilateralen Beziehungen mit China so weit ausdehnt, dass andere EU -Staaten entfremdet werden.« Die Berliner Regierung müsse ihren »sinozentrierten Ansatz« überdenken, ihre Interessen diversifizieren. Und auch die New York Times kommentierte, die Partnerschaft zwischen Peking und Berlin sei inzwischen »so eng, dass es ungemütlich wird«. Die EU verhängte trotz Berliner Proteste Stafzölle. Im Juli einigte man sich mit den Chinesen – wohl nur vorübergehend.
Derzeit expandieren deutsche Unternehmen mit Pekings Einwilligung in China mehr denn je. Der Chemieproduzent Lanxess hat 2012 in Changzhou sein neues Investment gefeiert, 235 Millionen ließ er sich seine Anlage für synthetischen Kautschuk kosten. VW kündigte im Frühjahr 2013 an, in den kommenden Jahren sogar sieben neue Werke in China zu bauen. Doch so ganz wohl ist es derzeit nicht allen Dax-Unternehmen bei ihren Geschäften mit der Volksrepublik. Die neuen BASF -Zahlen etwa sollen enttäuschend sein, die Stimmung wirkt gedrückt. Alle hoffen auf mehr Transparenz durch die neue Pekinger Führung – und auf ein Ende der gezielten Cyberattacken und der mit ihnen verbundenen Werkspionage. Da half auch wenig, dass Martin Winterkorn, VW -Chef und bestbezahlter deutscher Manager, im Sommer 2013 von der KP offiziell zu einem der 14 internationalen »Berater« für die VR China ernannt wurde.
Ein ungebrochener, sich sogar verstärkender Expansionsdrang und eine Marktentwicklung auf ausländische Investoren – das ist die eine Seite der chinesischen Ökonomie. Die andere Seite ist die Wirtschaft in der Heimat: Da läuft es derzeit lange nicht so gut. Manche sprechen sogar von einer Blase, die platzen könnte, sehen die »chinesische Party« zu Ende gehen. Auch all die Experten, die das für Panikmache halten, müssen zugeben: Chinas Motor ist ins Stocken geraten. Die Börse sank
Weitere Kostenlose Bücher