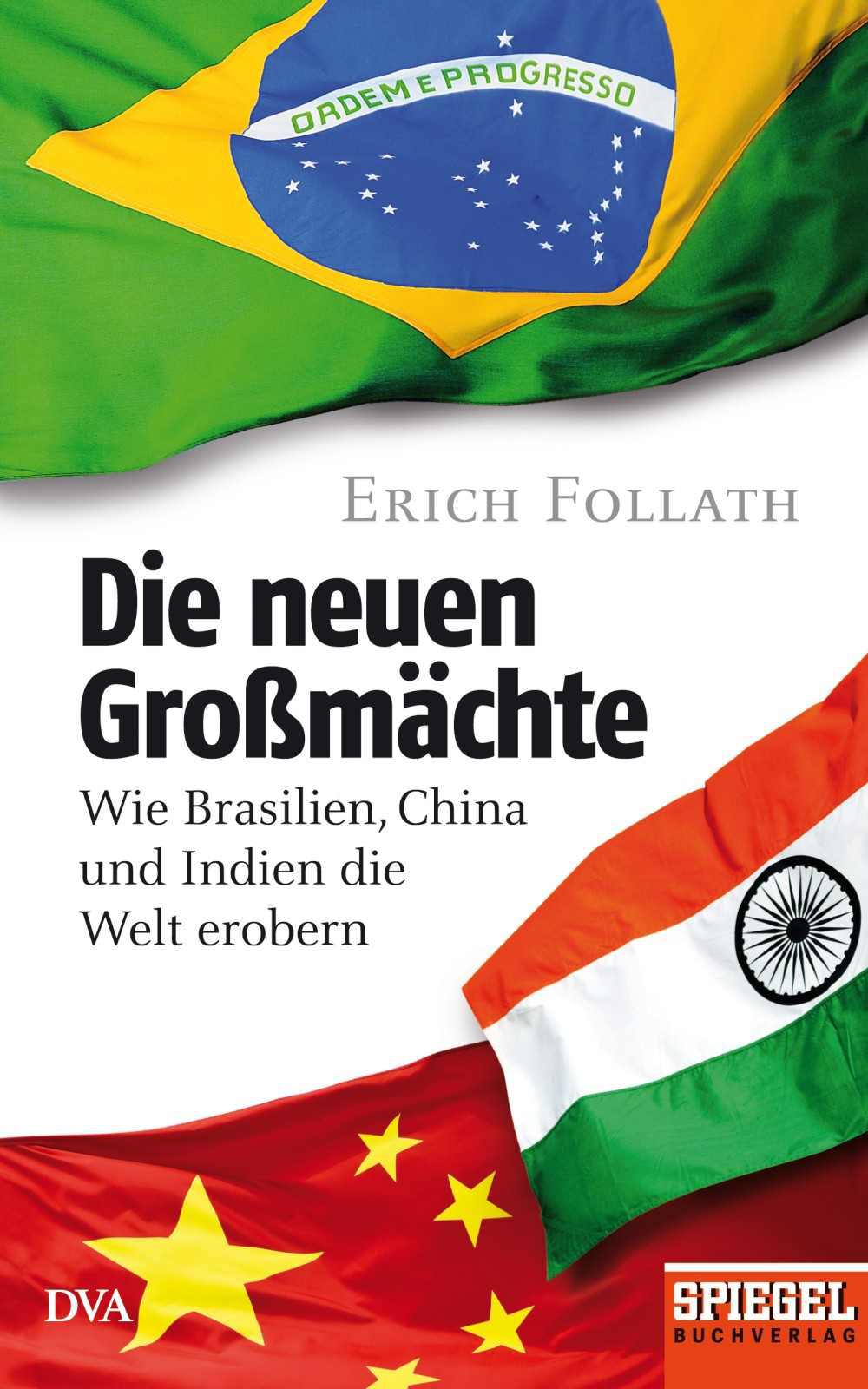![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
zwischenzeitlich auf ein Dreijahrestief, der Anstieg der Industrieproduktion bleibt unter den Erwartungen. Ganze Branchen leiden unter geringer Nachfrage – der Bau von Schiffen und das Zusammenbasteln von Weihnachtsschmuck rechnen sich bei den gestiegenen Lohnkosten nicht mehr. Und so erlebt die Volksrepublik eine Zweiteilung: Ihre Spitzenunternehmen wie Lenovo (Computer), Sany (Maschinenbau) und Huawei, das gerade als Netzwerkausrüster Ericsson überholt und zum Weltmarktführer geworden ist, feiern Triumphe. Die übrige Industrie aber muss sich in einem schmerzhaften Prozess weitgehend neu erfinden. Schluss mit der Werkbank der Welt, hin zu einer höheren technologischen Entwicklungsstufe, fordern deshalb Experten: Chinas derzeitiges Wirtschaftsmodell müsse »dringend geändert« werden, heißt es in einem – erstaunlicherweise von der Regierung in Peking mitherausgegebenen – höchst kritischen Bericht der Weltbank vom März 2012. Ohne grundlegende Reformen setze China seine bisherigen Reformen aufs Spiel. Es gelte, den monopolartigen Einfluss der Staatsbetriebe einzudämmen, die Macht jener Interessengruppen zu beschneiden, die von den »speziellen Beziehungen mit Entscheidungsträgern profitieren«. Kernsatz der Studie: »China steht an einem Wendepunkt.«
Was in diesem Land schiefläuft, zeigt sich eindrucksvoll in Dongguan, der Millionenstadt im Perlflussdelta, Heimat des größten Kaufhauses der Welt. Auf den 660000 Quadratmetern verlieren sich nur wenige Konsumenten, mehr als 90 Prozent der neuen Läden am zentralen »Canal Grande« haben dichtgemacht, auch an der »San Francisco Bridge« sind die Boutiquen verwaist. Die Mall ist vorbeigeplant worden an den wahren Bedürfnissen der Menschen. Nun muss nachjustiert werden, Spezialisierung statt Größenwahn ist angesagt – wie in ganz Dongguan, das lange hinter Schanghai und Shenzhen drittgrößte Exportstadt der Volksrepublik war. Heerscharen von Wanderarbeiter produzierten hier vor Kurzem noch alles im Überfluss, was Europa und die USA billig konsumieren mochten, von Billiguhren bis Billighandys. Wie ein gigantisches Dickicht wucherte die Ansammlung von Werkhallen und Wanderarbeiterunterkünften in der südchinesischen Exportprovinz nahe Hongkong. Doch jetzt ist dieses Dongguan dabei, ein Auslaufmodell zu werden. Das liegt an der mangelnden Kauflust der krisengeplagten Westler, aber auch daran, dass sich China, ähnlich wie einst Japan und Südkorea, mit Riesenschritten zu einer reiferen und auch schneller alternden Industriegesellschaft wandelt. Die Folgen: steigende Löhne und höhere Kosten sowie strengere Arbeitsschutz- und Umweltauflagen. Viele Hersteller von Spielzeug und Schuhen sind bereits in noch preisgünstigere Länder abgewandert, etwa nach Kambodscha.
Für Chinas Vordenker gilt es, in Sachen Zukunftssicherung Berge zu versetzen – und das tun sie, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein riesiges rotbraunes Areal, das derzeit am Rand Dongguans auf abgetragenem Erdreich entsteht, soll eine »Startrampe in das hochtechnologische Zeitalter der Volksrepublik werden« und den Namen Dongguan »weltweit zu einem Begriff auch für Nobelpreisträger machen«, sagt Kernforscher Zhang Bingyun, der Prophet einer neuen Ära. In fünf Jahren will er hier mit Hunderten Kollegen Chinas erste Spallations-Neutronenquelle in Betrieb nehmen. Derzeit existieren weltweit nur vier derartige Anlagen. »Wir werden gewaltige Fortschritte bei der Entwicklung neuer Werkstoffe machen, aber auch in der Biotechnologie und der Genetik«, sagt der Wissenschaftler. In Dongguan, so hofft er, könnten sich dann private Hightech-Firmen ansiedeln und Produkte weiterentwickeln. Zunächst aber ist es eben wieder der Staat, der hier baut. Mit ihrer Investition wollen die KP -Planer die vielbeschworene »heimische Innovation« vorantreiben, Kreativität auf Befehl. Und somit ist auch diese Baustelle zum Schlachtfeld der Ideologen geworden: Braucht das Land mehr gut zu regulierenden Staatskapitalismus und Arbeitermassen, vom Land in die Städte geschickt, um immer effektiver für den Rest der Welt zu produzieren – wie die sogenannten Konservativen meinen? Oder mehr Privatunternehmen mit Hightech-Potenzial, die aber auch leicht zu politischen Unruheherden werden, den Absolutheitsanspruch der KP untergraben könnten – wie die sogenannten Liberalen denken?
Der politisch-ökonomische Mix, der Chinas Wirtschaftswunder der vergangenen drei Jahrzehnte gefördert hat, war ideal dafür,
Weitere Kostenlose Bücher