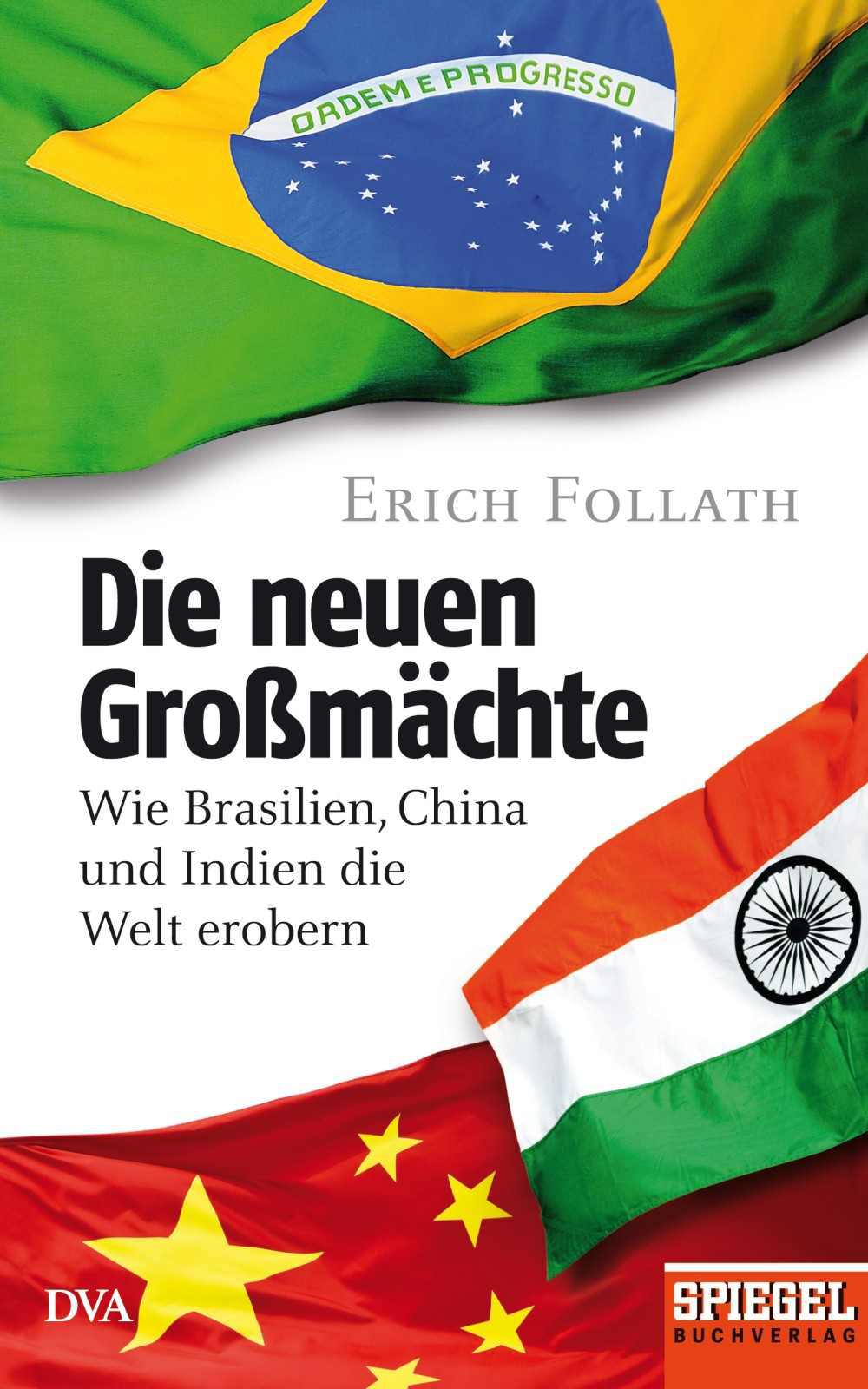![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
sehr die »klassischen« Probleme des sozialen Aufstiegs wie den neuen Kleinwagen, die Wohnung, die Kleidung. Es geht um nichts weniger Essenzielles: das gesunde Leben.
Im Februar 2013 sah die Hauptstadt des Boom-Staates China über Wochen so aus wie die Kulisse eines Films über den Untergang der Welt. In Peking ging wegen der extremen Luftverschmutzung gar nichts mehr. Die Feinstaubbelastung stieg auf absurde tausend Mikrogramm pro Kubikmeter, das Vierzigfache dessen, was die Weltgesundheitsorganisation gerade noch für vertretbar hält. An vielen Tagen wurde den Kindern der Sportunterricht im Freien verboten, an manchen schlossen die Schulen ganz. Elite-Institute wie das Dulwich College errichteten für ihre Zöglinge über ihren Tennisplätzen sogenannte »Sport-Dome«, abgeschlossene Räume mit künstlich frischer Luft. Plötzlich waren nicht mehr Gucci und Prada die erstrebenswertesten Luxusgüter, sondern »Purifier«; die Schweizer Firma IQA ir stellte die Säuberungsgeräte in ihrem Showroom aus wie Schmuckstücke, im Preis lagen sie ähnlich: 3000 US -Dollar für ein Gerät der gehobenen Klasse. Gesichtsmasken wurden zum Teil des städtischen Dresscode. Eine von den Pekinger Behörden unterdrückte Studie kam zu dem Ergebnis, dass in China derzeit 1,2 Millionen Todesfälle pro Jahr allein auf die extreme Luftverschmutzung zurückzuführen seien. Eine Untersuchung der Deutschen Bank in Peking sagte »bei den gegenwärtigen Trends des Kohleverbrauchs und der Auto-Emissionen« eine weitere Verschlechterung der Luftqualität um 70 Prozent voraus. Die Website der US -Botschaft in Peking, die unabhängige eigene Messwerte veröffentlichte – sie lagen regelmäßig höher als die offiziellen chinesischen –, wurde zur populärsten Informationsquelle der Pekinger: Wer konnte, begann den Tag mit einem Blick auf die neuesten Zahlen.
Viele Flüsse und Seen in der Volksrepublik sind so vergiftet, dass die Behörden die Ufer weiträumig sperren müssen. Obst und Gemüse, das auf den verseuchten und überdüngten Böden der Volksrepublik gezogen wird, enthält gefährliche Schadstoffe. Viele meiner Freunde in Peking kaufen nur noch in Bioläden und essen in teuren Biorestaurants, weil sie glauben, ihren Familien die »normalen« Lebensmittel nicht mehr zumuten zu können. Dazu kommen immer wieder Ausbrüche von gefährlichen Seuchen wie der Vogelgrippe, die offensichtlich durch extrem unhygienische Tierhaltung ausgelöst oder zumindest beschleunigt werden. Als in Schanghai im Frühjahr 2013 Tausende von Schweinekadavern in einem Fluss entsorgt wurden, der auch als Trinkwasserquelle fungierte, überraschte das schon fast keinen mehr.
Auch bei der Kindernahrung droht permanent eine Verschmutzung. Schlimmer noch: Kriminelle Hersteller haben schon mehrfach Babymilch gepanscht und so schwere Erkrankungen von Zigtausenden Kindern in Kauf genommen. Chinesische Eltern haben offenbar jedes Vertrauen in die chinesischen Autoritäten verloren, solcher Machenschaften Herr zu werden. Sie kaufen die Gläschen im Ausland oder schicken ihre Bekannten mit dem Auftrag los. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise in Australien zeitweise Babynahrung komplett ausverkauft war und nach Beschaffung von Nachschub rationiert werden musste. Selbst in Berlin wurde im April 2013 wegen der großen chinesischen Nachfrage Babynahrung nur noch in geringen Einzelmengen ausgegeben.
Grundsätzlich hat die Partei das Umweltproblem erkannt. Die Leistung regionaler Parteichefs soll künftig nicht mehr nur am Wachstum und den Investitionen gemessen werden, sondern auch an Öko-Standards. Die KP will mit Milliarden den Ausbau alternativer Energien fördern, manche sprechen sogar schon von einer »grünen Revolution« im Reich der Mitte. Die Zahlen sprechen eher dagegen: Noch immer wächst die Umweltverschmutzung schneller als die Wirtschaft. Nach Berechnungen von Experten müsste die Volksrepublik 3 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts ausgeben, um die bestehende Verunreinigung allmählich abzubauen. Doch nach den jüngst bekanntgewordenen Zahlen des nächsten Fünfjahresplans sind nur 1,4 Prozent des BIP an Ausgaben vorgesehen.
Wer es sich leisten kann und auf der Vermögensleiter ganz oben angekommen ist, denkt in Peking an etwas anderes. Vergnügt sich, so lange es noch geht. Und dreht am ganz großen Rad. Jedes Wochenende treffen sich in einer vornehmen Lounge nahe dem Fußballstadion die Mitglieder des Beijing Sports Car Club, gegründet 2009. Da
Weitere Kostenlose Bücher