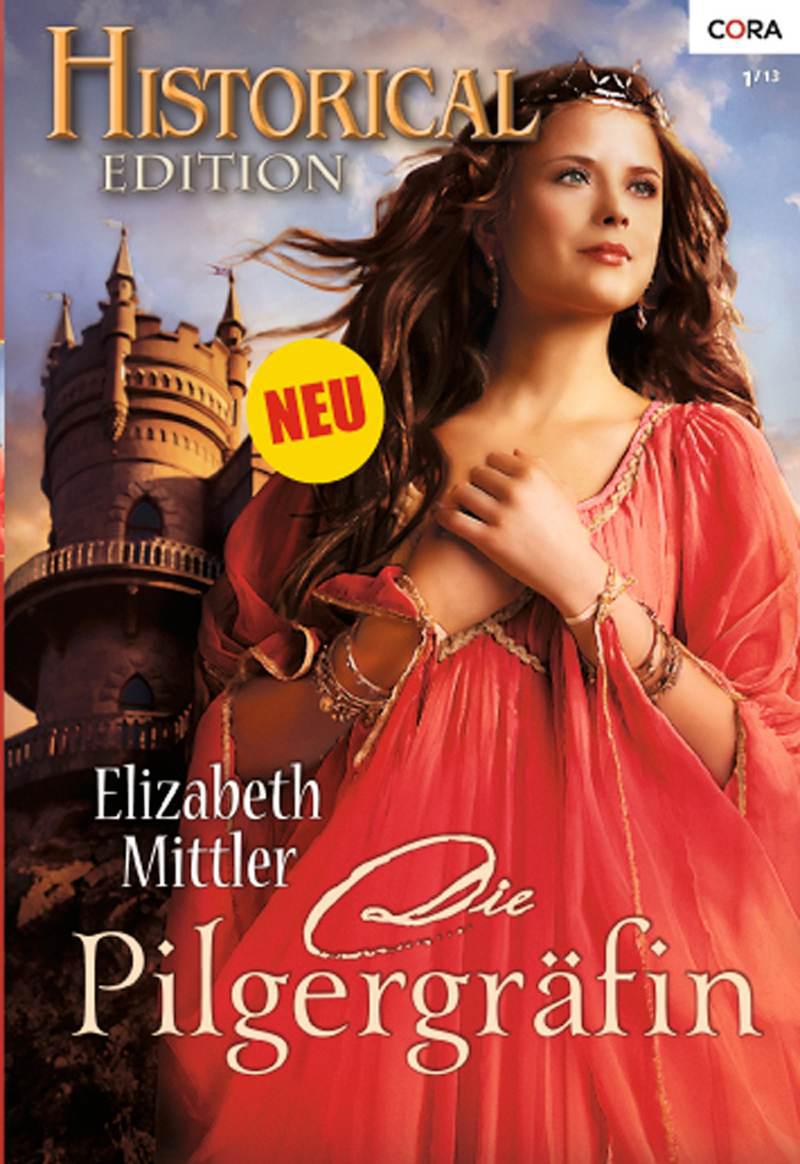![Die Pilgergraefin]()
Die Pilgergraefin
weiter: „Gott hat mir bereits einen Erben geschenkt. Den lieben Sigismund. Er wird die glorreiche Linie der Attenfels fortsetzen. Ihr braucht mir keinen Stammhalter zu gebären, denn wir beide werden einander genug sein.“ Dass er den fünfzehnjährigen Sigismund für einen ausgemachten Schwachkopf hielt, musste er Leonor gegenüber ja nicht erwähnen. Und außerdem war es ihm ziemlich gleichgültig, was mit der glorreichen Linie der Attenfels geschah. Hatte Gevatter Tod erst einmal zugeschlagen, war sowieso alles zu Ende. Es waren allein irdische Vergnügungen, die zählten – und davon kannte er eine ganze Menge.
Leonor überlief ein kalter Schauder. Ihre Notlüge hatte ihr nicht geholfen. Musste sie ihre Schuld am Tod des Gatten und des Sohnes tatsächlich damit büßen, dieses grausame Scheusal zu ehelichen? Hatte der Himmel ihr diesen Weg zugedacht? Nein, das konnte sie nicht glauben! Buße tun – ja, das wollte sie. Aber dafür musste es eine andere Möglichkeit geben als die, die Gemahlin dieses schrecklichen, unbarmherzigen Mannes zu werden. Auf einmal ergriff sie ein Schwindel, den sie zu bekämpfen suchte, um sich vor dem Baron keine Blöße zu geben.
„Wasser“, flüsterte sie, einer Ohnmacht nahe. Doch kein Kelch mit kühlem Nass wurde an ihre trockenen Lippen geführt. Stattdessen spürte sie die knochigen Finger des Barons an ihrer Wange, lange, spitze Fingernägel, die ihr über die Haut fuhren. Ihr wurde schlecht, und wie leblos sank sie in ihrem Armstuhl zusammen.
Dass sie dabei mit kalten Augen, in denen eine diabolische Vorfreude glomm, betrachtet wurde, bekam sie nicht mehr mit.
4. KAPITEL
O h, Chevalier, wie weit ist es denn noch? Gibt es nicht bald ein Gasthaus, wo wir einkehren und uns stärken können? Mein Ross ist müde, und – mit Verlaub – mein Arsch schmerzt teuflisch.“
Missbilligend betrachtete Robyn de Trouville seinen Knappen Jérôme. Seit sie sich auf dieser bedeutsamen Mission befanden, jammerte der Jüngling unentwegt. Sein gesamtes Trachten und Denken war allein auf das nächste Wirtshaus gerichtet, wo er sich nach einer herzhaften Mahlzeit ausstrecken und der Ruhe frönen konnte. Parbleu , warum hatte er dieses Weichei nur in seine Dienste genommen? Und auf diese lange Reise, die ihn, möglicherweise sogar jenseits von Frankreichs Grenzen, an ein Ziel führen sollte, wo er, wenn er den Auftrag zum Gefallen seines erlauchten Herrschers erfolgreich durchführte, Ruhm, Ehre und vielleicht sogar den Grafengürtel erringen konnte.
Zwar hoffte er, seine Mission würde in Avignon beendet sein, doch es war durchaus möglich, dass er weiter nach Italien – nach Mailand oder gar in die Ewige Stadt – reiten musste.
Immerhin verstand Jérôme es, die Pflichten eines Knappen meist recht gut zu erfüllen. Und da er der Sohn seiner Cousine Géraldine war, hatte er deren Bitte, den etwas verweichlichten Knaben unter seine Fittiche zu nehmen, schlecht abschlagen können. Er solle einen rechten Mann aus ihm machen, hatte sie ihm gesagt. Nun, auf ihrem langen Ritt nach Avignon, dem Exil des Papstes, sollte genug Zeit und Gelegenheit dazu sein.
Halb belustigt, halb verärgert, musterte er den dicklichen Jüngling, der schlapp im Sattel seines Wallachs hing. „Halte durch, Jérôme! Bis zum nächsten Gasthaus dürften es nur noch fünf oder sechs Meilen sein.“
„Fünf … oder … sechs … Meilen“, japste Jérôme. „Ihr beliebt zu scherzen, Chevalier. Denkt doch nur an meinen armen Filou. Schon jetzt plagen ihn Hunger und Durst, ganz zu schweigen von …“ Ein lautes Magenknurren verriet, dass wohl weniger das Pferd als Jérôme selbst einer stärkenden Mahlzeit bedurfte.
„Ihr seid immer so wortkarg. Das macht den Ritt recht eintönig“, murrte der Knappe. „Erzählt mir doch wenigstens, wie es dazu kam, dass der König Euch zu seinem Kurier erwählte. Meine Mutter vermochte mir dazu keine Auskunft zu geben.“ Jérôme wusste nicht viel über den Cousin seiner Mutter, den er nur wenige Male auf Familienfesten gesehen und dabei kaum einmal mit ihm gesprochen hatte. Jedoch erfüllte ihn der Gedanke, in geheimer Mission mit dem Chevalier unterwegs zu sein, mit Stolz.
Robyn bedachte seinen Schildknecht mit einem unwilligen Blick, entschloss sich dann jedoch dazu, ihn mit wenigen Worten ins Bild zu setzen. „Ach, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Vor einigen Jahren konnte ich dem Duc de Montmorillon, dessen Herzogtum, wie du womöglich weißt, an die
Weitere Kostenlose Bücher