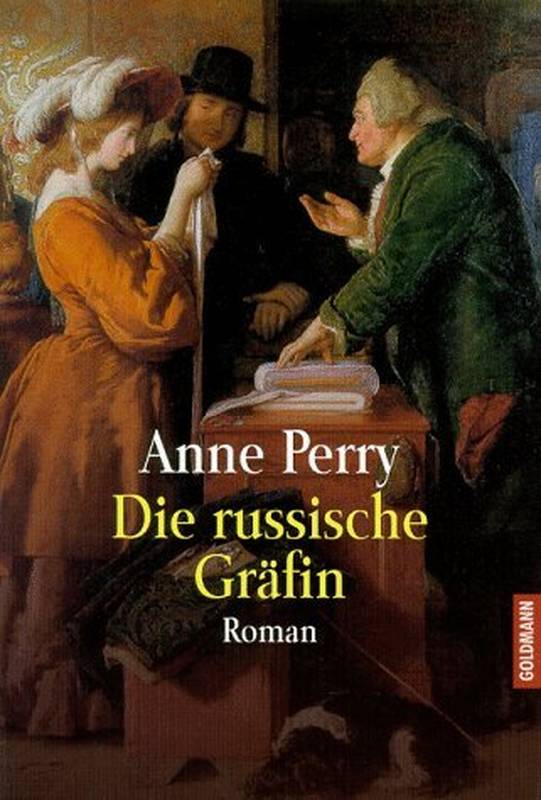![Die russische Gräfin]()
Die russische Gräfin
auf einen abgewetzten braunen Stuhl. »Sie werden verstehen, wenn ich jetzt als advocatus diaboli auftrete. Ich werde nach Schwachstellen fahnden, und wenn ich welche finde, weiß ich, wo die Verteidigung ansetzen kann.«
»Selbstverständlich!« rief Gallagher eifrig. »Fahren Sie fort!« Monk spürte einen Anflug von Gewissensbissen, ließ sich davon aber nicht beirren. Was zählte, war die Wahrheit. »Waren Sie der einzige Arzt, der Prinz Friedrich behandelte?«
»Ja, vom Unfall bis zu seinem Tod.« Bei der Erinnerung wurde Gallagher blaß. »Ich… ich dachte wirklich, er sei auf dem Weg der Besserung. Eigentlich sah es so aus, als wäre er schon über den Berg. Natürlich hatte er große Schmerzen, aber das ist bei Knochenbrüchen normal. Das Fieber hatte dafür merklich nachgelassen, und er nahm sogar wieder etwas Nahrung zu sich.«
»Wie ging es ihm bei Ihrem letzten Besuch vor dem Rückfall?«
»Er saß aufrecht im Bett.« Gallagher wirkte bekümmert. »Er schien sich über meinen Besuch zu freuen. Ich sehe die Szene noch genau vor mir. Es war Frühling, wissen Sie, Frühlingsende. Das Wetter war herrlich. Das Sonnenlicht flutete durch die Fenster herein. Auf dem Sekretär stand eine Vase voller Maiglöckchen – sie füllten das ganze Zimmer mit ihrem Duft. Das waren die Lieblingsblumen der Prinzessin. Wie ich gehört habe, kann sie sie seitdem nicht mehr sehen. Armes Ding. Sie hat ihren Mann doch so vergöttert. Von dem Moment, in dem er schwerverletzt ins Haus getragen wurde, wich sie nicht mehr von seiner Seite. Sie war verzweifelt, schrecklich verzweifelt. Außer sich vor Sorge.«
Er holte tief Luft und ließ sie langsam ausströmen. »Als er starb, war sie völlig anders. Man hätte meinen können, das Ende der Welt wäre für sie gekommen. Sie war leichenblaß, saß bloß da, rührte sich nicht und sagte kein Wort. Sie schien uns gar nicht wahrzunehmen.«
»Woran starb er?« fragte Monk mit sanfter Stimme. Er spürte, wie aufgewühlt dieser Mann war. »Im medizinischen Sinne.«
Gallaghers Augen weiteten sich. »Ich habe keine Autopsie vorgenommen, Sir. Er war doch ein Königssohn! Er starb an den bei seinem Sturz erlittenen Verletzungen. Er hatte mehrere Knochenbrüche. Sie schienen zwar zu heilen, aber man kann nicht in einen lebenden Menschen hineinschauen und feststellen, welche Organe gequetscht oder durchbohrt wurden. Er ist inneren Blutungen erlegen. Sämtliche Symptome deuteten darauf hin. Ich hatte nicht damit gerechnet, weil er auf dem Wege der Besserung zu sein schien, aber das lag vielleicht auch an seinem Lebenswillen, der ihn auch dann nicht im Stich ließ, als er mit schweren inneren Verletzungen dalag, die bei der geringsten falschen Bewegung den Riß eines Gefäßes und tödliche Blutungen herbeiführen konnten.«
»Die Sympome…«, gab ihm Monk mit leiser Stimme das nächste Stichwort. Was oder wer auch immer schuld gewesen sein mochte, er hatte Mitleid mit dem Mann, dessen Tod er nun mit so klinischer Kühle zu ergründen suchte. Alles, was er über ihn gehört hatte, wies auf einen Mann von Mut und Charakterstärke hin, der seinem Herzen gefolgt war und dafür, ohne zu klagen, den Preis gezahlt hatte, einen Menschen, der zu tiefster Liebe und Aufopferung fähig war, einen von seinem Pflichtbewußtsein durchdrungenen Mann, der am Ende vielleicht gerade deswegen ermordet worden war.
»Kälte«, erklärte Gallagher. »Klamme Haut.« Er schluckte, seine Hände verkrampften sich. »Schmerzen im Unterleib. Übelkeit. Ich glaube, daß dort die Blutung ausbrach. Dem folgten der Verlust der Orientierung, Schwindel, Taubheit an Händen und Füßen, Koma und schließlich der Tod. Herzversagen, um es genau zu sagen. Das sind die Symptome innerer Blutungen.«
»Gibt es Gifte, die ähnliche Symptome hervorrufen?« Monk runzelte die Stirn, als widerstrebe es ihm, diese Frage zu stellen.
Gallagher starrte ihn an.
Monk dachte an die Eiben am Ende der Hornbaumhecke, die den Steintrog so überschattet hatten. Jedermann wußte, daß die nadelartigen Eibenblätter hochgradig giftig waren. Und sie waren für alle im Haus zugänglich. Man brauchte nur im Garten spazierenzugehen – die natürlichste Sache der Welt. »Gibt es welche?«
Stephan scharrte mit den Füßen.
»Gewiß«, sagte Gallagher widerstrebend. »Es gibt Tausende von Giften, aber warum, in Gottes Namen, sollte eine solche Frau ihren Mann vergiften wollen? Das ergäbe doch überhaupt keinen Sinn!«
»Könnten Eibenblätter
Weitere Kostenlose Bücher