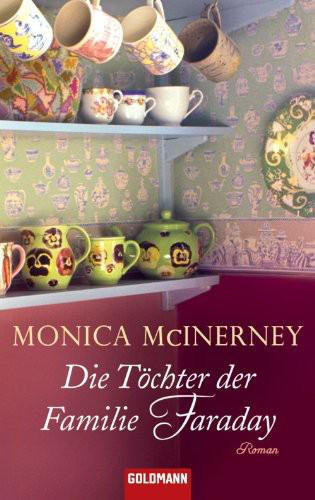![Die Toechter der Familie Faraday]()
Die Toechter der Familie Faraday
sagen hatte, und dabei beließ sie es. Allein ihre Anwesenheit wirkte auf Miranda beruhigend.
Wer behauptet, dass man unter Geschwistern keine Favoriten hat, der hat keine Familie, dachte Miranda. Doch wer die Favoritin war, das änderte sich ständig. Bündnisse lösten und bildeten sich neu. Es war wie die Parodie eines Volkstanzes, jedes Paar wurde nach kurzer Zeit durch einen Taktwechsel gezwungen, sich voneinander zu lösen und sich anderen Partnern zuzuwenden.
Miranda hatte immer mit einer ihrer Schwestern einen Kampf auszufechten, zog eine andere ins Vertrauen und sprach mit noch einer anderen kaum. Das Ganze folgte keinem bestimmten Muster. Manchmal ergab sich das rein zufällig. Es hing davon ab, wer zuerst von der Schule oder der Arbeit nach Hause kam, welche Schwester zuerst den Wortschwall nach Feierabend hören musste, was zu Vertraulichkeiten oder zu Streitigkeiten führen konnte. Fünf Schwestern, fünf sehr verschiedene Persönlichkeiten, auch wenn die Leute ihren Vater oder ihre Mutter auf der Straße so oft angesprochen, auf die Mädchen in ihren Schuluniformen oder Sonntagskleidern geschaut und kundgetan hatten, wie ähnlich sie sich doch alle sähen, mit ihrem dunklen Haar, den dunklen Augen und der blassen Haut: »Ihr Faraday-Mädchen gleicht euch wirklich wie ein Ei dem anderen.«
Nein, tun wir nicht, hatte Miranda dann immer wütend widersprechen wollen. Darum färbte sie sich auch, seit sie es sich leisten konnte, das Haar rot. Im Grunde seit noch längerer Zeit. Davor hatte sie nämlich die Vertreter der Kosmetikfirmen um Proben angebettelt.
Clementine änderte ihre Haltung und holte Miranda aus ihren Gedanken. Sie wandte sich an ihre kleine Schwester. »Es tut mir leid, Clementine.«
»Ist schon gut.«
»Ich will nun einmal mehr. Vielleicht sollte ich wirklich ausziehen. Bevor ich wieder die Wäsche machen muss. Ich hasse das Waschen.«
»Du hasst doch alles außer Flirten und Selbstbewunderung im Spiegel.«
Miranda lachte. Ihre Wutanfälle waren nie von langer Dauer. Sie zog ihre Schwester an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Liebe kleine Clemmie. Und ich dachte, ich hätte dich blenden können.«
»Keinen Augenblick lang. Und klein bin ich auch nicht. Oder Clemmie. Ich bin Clementine und bald schon Mutter, also bin ich emotional und körperlich reifer als du. Und jetzt lass mich los. Du stinkst nach Rauch.«
Miranda war nicht beleidigt. Sie schob sich ein Pfefferminz in den Mund, warf den Zigarettenstummel in den Garten, straffte übertrieben die Schultern und holte tief Luft. »Zurück ins Gefecht. Du voran, damit ich im Schatten der gereiften, fast-schon-mütterlichen Clementine folgen kann.«
Clementine blieb mit ernster Miene stehen. »Du ziehst doch nicht wirklich aus, Miranda, oder? Das würde alles ändern, und ich möchte doch, dass mein Kind euch alle richtig kennenlernen kann.«
»Ich komme ja hin und wieder zu Besuch, selbst wenn ich ausziehen sollte. Dann fliege ich eben aus Rio oder irgendeiner anderen aufregenden Stadt, die ich bald mein Zuhause nennen werde, ein.«
»Mach dich nicht immer über alles lustig. Du hältst doch die Familie zusammen, das weißt du.«
»Nein, das tue ich nicht.« Miranda seufzte. Auch sie sah ernst aus. »Diese Familie wird von hauchzarten Fäden aus Lügengespinsten und Erinnerungen zusammengehalten, Clem. Mit mir hat das gar nichts zu tun.«
»Irgendwer zu Hause?«, rief Juliet, als sie die Haustür öffnete, ihren Mantel auszog und auf einen der wackeligen Haken über die anderen Mäntel hängte.
Acht hingen dort immer, wenn sie auch niemals getragen wurden. Auch der Schuhschrank war voller Schuhe, die man niemals an einem Fuß sah. Es juckte Juliet in den Fingern, einmal gründlich aufzuräumen und alles wegzuwerfen. Nicht nur die Kleider und Schuhe. Auch die verblichenen Gemälde. Die fadenscheinigen Teppiche. Sogar das angeschlagene blau-weiße Geschirr. Natürlich stand das außer Frage. Es hatte alles ihrer Mutter gehört und war mit ihr von Irland nach England und schließlich mit all ihren anderen Besitztümern von dort nach Tasmanien gewandert.
Wenn ihre Mutter noch am Leben wäre, gäbe es vermutlich trotzdem Diskussionen darüber, ob sie etwas wegwerfen durften. Ihre Eltern hatten darüber stets scherzhaft gestritten: Leo wollte etwas Neues kaufen, Tessa das Alte behalten. Doch seit dem Tod ihrer Mutter hatte ihr Vater nichts mehr weggeworfen.
Es war ein regelrechter Schock für sie gewesen, als Juliet
Weitere Kostenlose Bücher