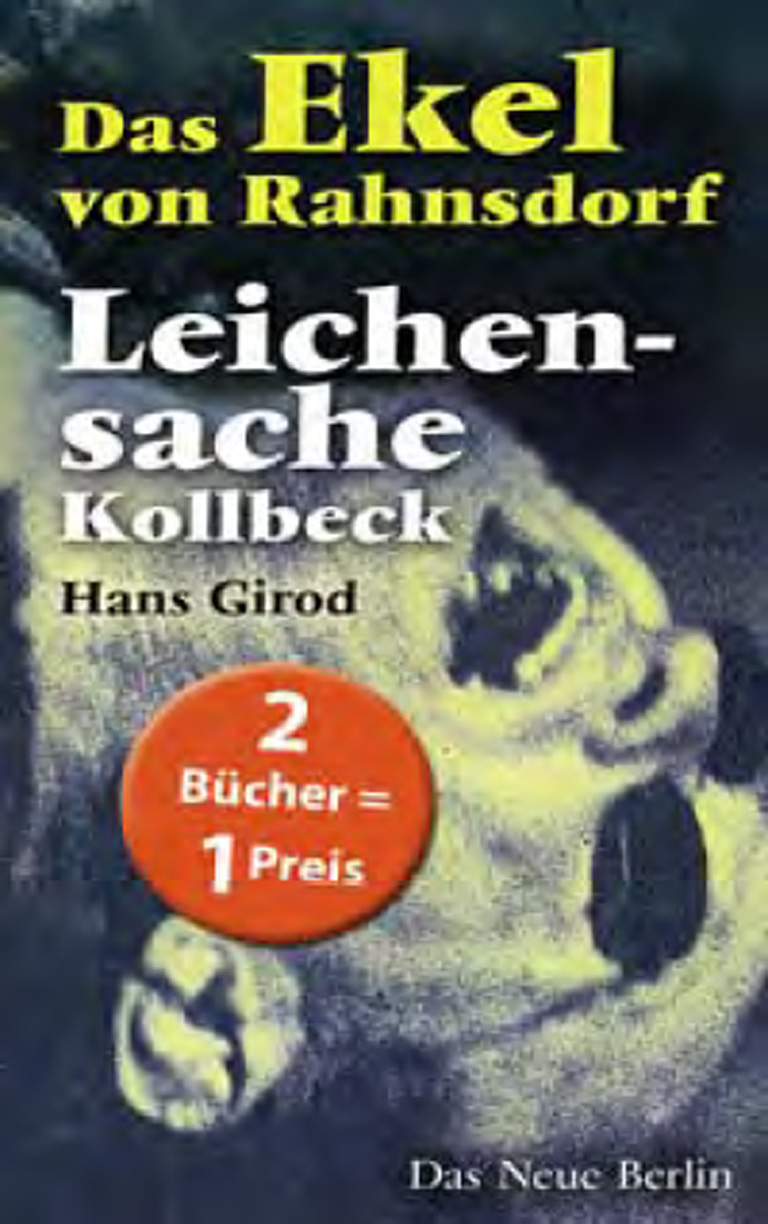![Ekel / Leichensache Kollbeck]()
Ekel / Leichensache Kollbeck
zur Folge. Aus ihnen lassen sich, neben dem Nachweis des Geschlechts, der Blutgruppenformel und des sogenannten genetischen Fingerabdrucks, häufig auch Rückschlüsse auf den Tathergang, die benutzten Werkzeuge und andere wichtige Umstände, wie die Anwesenheit einer bestimmten Person, alkoholische oder medikamentöse Beeinflussung der Beteiligten, ziehen. Ihre Untersuchung obliegt den Spezialisten in den Polizeilabors oder den Instituten für Rechtsmedizin.
Ein unbestrittener Vorzug der modernen Kriminalistik besteht vor allem darin, daß bereits eine höchst geringe Substanzmenge (mitunter nur eine einzige Körperzelle) ausreicht, um zu beweiserheblichen Aussagen zu gelangen. Vorproben und Nachweisverfahren reagieren mitunter so empfindlich, daß der Laie seine Ehrfurcht kaum zurückzuhalten vermag. So stelle man sich vor, daß in ein Gefäß, gefüllt mit etwa acht Eimern Wasser, ein Blutstropfen gelangt. Das entspricht einer Verdünnung in homöopathischen Größenordnungen. Bereits eine simple Vorprobe, deren Aufgabe lediglich darin besteht, zu klären, ob der Verdacht von Blutvorkommen aufrecht erhalten werden kann, zeigt bereits eine positive Reaktion.
Man kann sich daher leicht vor Augen halten, welcher Mühe es bedarf, um eine Blutspur so zu beseitigen, daß ein Nachweis unmöglich wird.
Viele Täter unterschätzen diese Tatsache und beschränken sich auf eine nur oberflächliche Beseitigung. Dem Kriminalisten obliegt bei der Tatortuntersuchung eines Tötungsdelikts die Aufgabe, das Vorhandensein von Blutspuren in seine Überlegungen auch dann einzuschließen, wenn sie augenscheinlich nicht erkennbar sind.
Als Leutnant Lorenz am nächsten Tag ein Gutachten in den Händen hält, das die Identität der Blutgruppe des ermordeten Lutz Bolke mit den Spuren aus der Wohnstube bestätigt, ist er mit dem Ermittlungsergebnis sichtlich zufrieden. Nun kann er die Überprüfung des Fahrtenbuchs des beschuldigten Kraftfahrers Günter Linke vornehmen. Immerhin müßte daraus für die fragliche Zeit eine Differenz von etwa 160 km nachzuweisen sein. Doch die Eintragungen sind lückenlos, und sämtliche Fahrten wurden durch seinen Chef unterschriftlich bestätigt. Es bedarf einer zeugenschaftlichen Vernehmung des Vorgesetzten von Günter Linke, um herauszufinden, wie unkritisch und leger die Fahrtenbestätigung erfolgte. Seine Aussage, alles unterschrieben zu haben, was ihm vorgelegt wurde, erlaubt den Schluß, daß Linke die 160-Kilometer-Differenz ohne Schwierigkeiten mit anderen Fahrten „verrechnen“ konnte.
Lorenz plant die Vernehmung der beiden Beschuldigten mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit. Zunächst läßt er Sybille Bolke vorführen. Eine Zeit lang sitzt dieses schwächlich wirkende Persönchen mit dem dunklen, schulterlangen Haar teilnahmslos auf einem Stuhl in gehöriger Distanz zum Schreibtisch von Lorenz. Dieser konzentriert sich nur auf Fragen zu ihrer Kindheit, ihrem Aufenthalt im Kinderheim, zum ständigen Streit mit dem Stiefvater und zur Lehrzeit als Fleischverkäuferin. Bereitwillig, zunächst leise, fast flüsternd, dann immer emotionsgeladener, spricht sie über ihre schwere Kindheit und die Situation in der total zerrütteten Ehe mit Lutz Bolke. Sie schildert Episoden aus dem unerträglichen Zusammenleben mit ihrem Gatten, der das mühsam verdiente Geld vertrank, sie grundlos prügelte und oftmals zum Geschlechtsverkehr zwang.
„Meine Ehe war ein großer Scheißhaufen. Sechs Kinder hat er mir gemacht. Aber mal im Haushalt helfen, nein, das war wohl nichts, nicht einen Finger hat der Herr gerührt. Ich hatte immer große Angst, erneut schwanger zu werden. Deshalb habe ich ihn freiwillig nicht mehr an mich herangelassen. Im Suff hat er mich geschlagen, dann hat er sich genommen, was er wollte! … Ich habe ihn gehaßt!“
„Wo sind denn Ihre Kinder gegenwärtig? Wir haben in Ihrer Wohnung doch nur zwei Kinderbetten vorgefunden“, fragt Lorenz.
„Die zwei ältesten leben bei mir, sie sind jetzt bei meiner Mutter in Spindlersfeld, das jüngste ist nach der Geburt gestorben, die anderen leben im Heim.“ Sie blickt Lorenz an, dann, als müßte sie sich vor ihm rechtfertigen, ergänzt sie: „Es war eben alles zu viel für mich.“
Lorenz will immer mehr wissen, dringt immer tiefer in Details des Ehelebens vor. Unmerklich lenkt er gleichzeitig das Gespräch auf die Tat und ihre Umstände. Die Fragen formuliert er vorsichtig und freundlich, ohne den Hauch eines Vorwurfs. Immer noch rechnet
Weitere Kostenlose Bücher