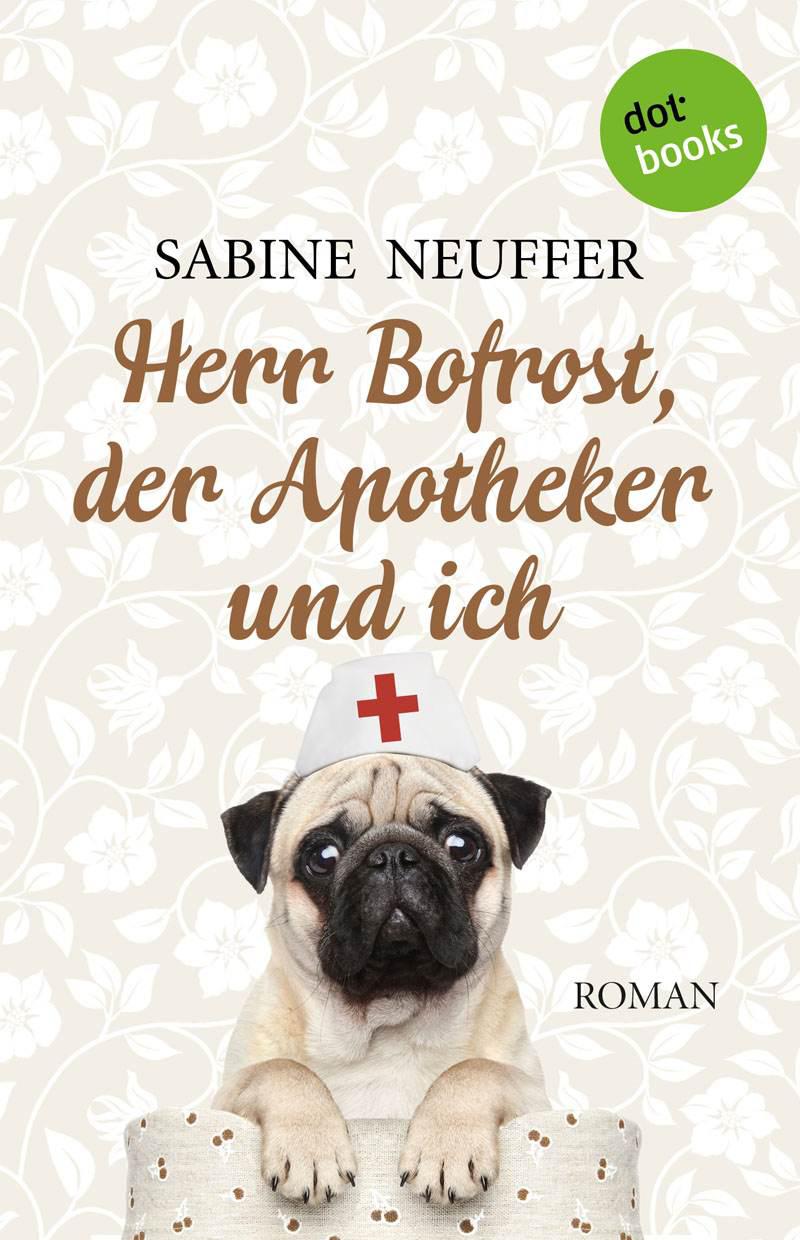![Herr Bofrost, der Apotheker und ich]()
Herr Bofrost, der Apotheker und ich
hatte und ich ihn nur angezickt hatte. Vielleicht war er Sozialarbeiter. Oder vom Tierschutzverein.
»Geben Sie mir Ihre Hand, sonst fallen Sie bloß wieder hin.« Er streckte mir seine Hand entgegen. Sie war groß und überraschend warm. Wir tappten mit vorsichtigen Schritten auf seinen Campingwagen zu, der vielleicht zehn Meter von uns entfernt stand. Es war ein Sven Hedin älteren Datums mit einem Hamburger Kennzeichen.
Der Fremde zog die Seitentür auf und forderte mich mit einer kleinen Verbeugung auf einzusteigen. Ich kletterte in den Wagen und atmete erleichtert auf. Unter meinen Füßen befand sich ein stumpfer, rutschfester Teppichboden, und warm war es hier. Mein Samariter schloss die Tür hinter sich. Ich drehte mich um und sah ihn blinzelnd an. Was er sah, wollte ich mir im Moment lieber nicht so genau vorstellen, stattdessen konzentrierte ich mich auf das, was ich sah. Braune Augen. Strubbeliges, braunes Haar unter der Kapuze seiner Winterjacke. Ein hübsches Gesicht. Was mir nicht gefiel, war, dass der Typ mich so intensiv anstarrte. »Sie haben gesagt, Sie hätten ein Handtuch für mich«, sagte ich patzig.
Er streifte seine Kapuze ab und öffnete einen der Oberschränke. Ich nutzte die Gelegenheit und sah mich um. Im hinteren Teil des Wagens befand sich zwischen zwei Sitzbänken ein Tisch, an einer der Seitenwände gab es eine winzige Küchenzeile, gegenüber war eine schmale Tür, die vermutlich zu einer Art Bad führte. Alles wirkte ein bisschen schäbig, aber es war gemütlich. Auf dem Tisch lagen ein Haufen Papiere und ein paar Bücher.
»Hier.« Der Mann hielt mir ein Handtuch hin. »Und da ist das Bad, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es diesen Namen verdient.« Er öffnete die kleine Tür, knipste das Licht über dem Spiegel an und machte eine einladende Geste. Am liebsten hätte ich das Licht sofort wieder ausgemacht, aber ich musste mich dem Desaster wohl stellen. Mein Haar klebte nass am Kopf, meine Nase leuchtete rot wie eine Signallampe, und mein Augen-Make-up ... oje! Ich sah aus wie ein grippekranker Pandabär. Als Erstes rubbelte ich mir die Haare trocken. Zum Glück waren sie kurz, von Natur aus lockig und sahen sowieso am besten aus, wenn ich sie an der Luft trocknen ließ. Dann wühlte ich in meiner riesigen Umhängetasche, die ich eigentlich seit mindestens einem Jahr ausmisten wollte. Ich war aber einfach noch nicht dazu gekommen, worüber ich jetzt froh war. Was ich fand, reichte für eine Restauration. Ich bürstete mein Haar, bis es glänzte, puderte meine Nase, bis sie nicht mehr glänzte, und betrachtete mich zufrieden. Ich will nicht angeben, aber meistens finde ich mich ganz hübsch. Natürlich bin ich von der klassischen Schönheit meiner Namensgeberin, der antiken Helena, weit entfernt, doch gerade das erfüllt mich mit klammheimlicher Befriedigung. Als meine Mutter diesen Namen für mich aussuchte, hatte sie bestimmt ein strenges, griechisches Profil vor Augen: gerade Nase, tiefbraune Augen und langes, glattes Haar – so wie die Malereien auf den Vasen, die sie damals ausbuddelte. Bei mir hingegen ist alles geschwungen und strebt an den Enden nach oben. Die Brauen ein wenig, die Mundwinkel ein wenig mehr, die Nase ziemlich. Und meine Augen sind blau und kullerrund. Meine Haare – wie gesagt. jetzt kringelten sie sich um Stirn und Ohren, die Locken sprangen in der Wärme auf und glänzten wie helles Gold im Licht der freundlich schwachen Lampe. Ich warf meine Kosmetikutensilien zurück in die Tasche und verließ das winzige Bad.
Als ich aus der Tür trat, stand mein unermüdlicher Sozialarbeiter am Herd und füllte gerade dampfendes Wasser in einen alten, braunen Teepott. »Setzen Sie sich, der Tee ist gleich fertig«, sagte er, ohne aufzuschauen.
Ich hängte meinen nassen Mantel an einen Haken neben der Tür, ließ mich auf einer der beiden Sitzbänke nieder und inspizierte die Bücher, die auf dem Tisch lagen. Ein Bildband über Design der sechziger Jahre, eine Churchill-Biographie, in der ein Lesezeichen steckte, ein Krimi von Petra Oelker, darunter das »NBA Magazine«. Eine sonderbare Mischung, aber nicht unsympathisch. Vielleicht war der Samariter ja ein Buchhändler aus Eimsbüttel, der sich auskennen und für jeden Geschmack gerüstet sein musste, im Herzen aber ein Basketballfan war. Und von gutem Tee schien er auch etwas zu verstehen. Der, den er mir eingoss, duftete köstlich!
Der verkappte Basketballfan setzte sich mir gegenüber. »Wir haben uns
Weitere Kostenlose Bücher