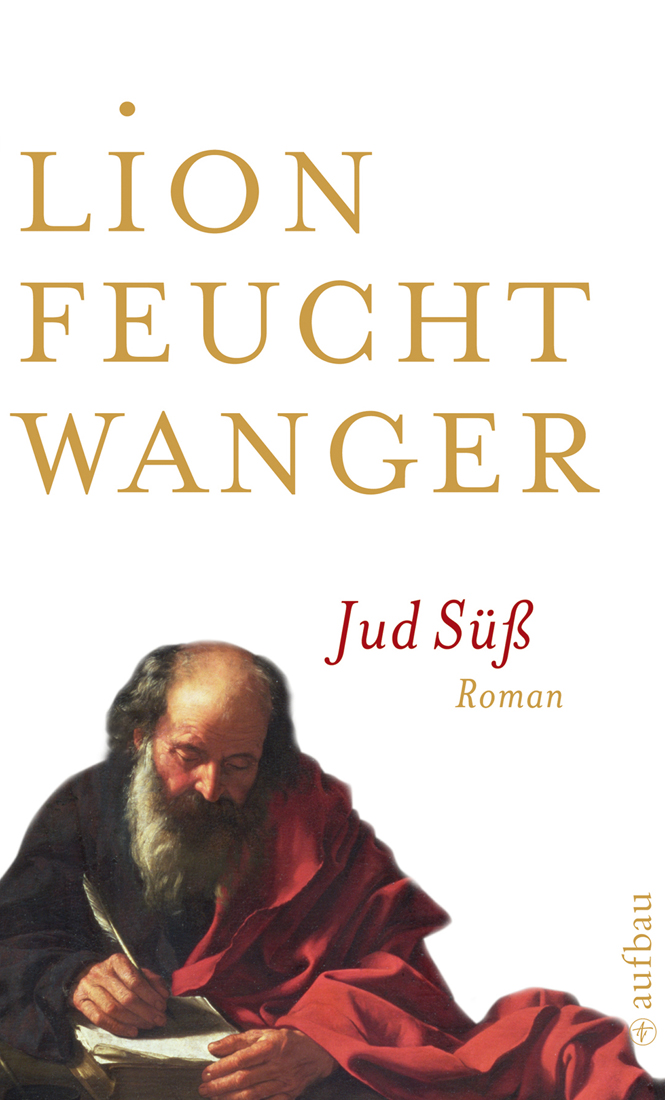![Jud Sueß]()
Jud Sueß
es einem Reichsfürsten verwehren, die Frau seines Ersten Ministers an seinem Hof zu haben? Und wie hatte die Christl gelacht, als er ihr für das Geld, das ihm sein Parlament für die Trennung bewilligt hatte, die Herrschaften Höpfigheim und Gomaringen kaufte.
Jetzt war es ruhig geworden. Wohl erschien da und dort noch ein Pasquill gegen die Gräfin, aber seine Verbindung mit ihr war nun an dreißig Jahre eine gegebene Tatsache deutscher, europäischer Politik. Die Stände knurrten, aber sie hatten gewissen Landverschreibungen an die Gräfin zugestimmt. Die Herzogin residierte kahl, sauer und resigniert im Stuttgarter Schloß, ihre Verwandten, die steifleinenen Markgrafen, hatten sich in ein ägriertes, hochmütiges Schweigen zurückgezogen. Man fand die Tatsachen unerhört, aber das tat man schon seit dreißig Jahren, man hatte sich hineingewöhnt, fügte sich.
Und jetzt also, eigentlich ohne bestimmten Anlaß, sollten alle Verbindungen mit der Frau sich lösen, fallen, nicht mehr da sein.
Sollten sie? Er hatte nicht gesprochen. Wenn er nicht wollte, war nichts geschehen.
Der Herzog stand auf der kotigen Landstraße, allein, barhaupt, in dem feinen, rieselnden Regen. Er zog den rechten Stulphandschuh ab und schlug ihn mechanisch gegen den Schenkel.
Oder war ein Anlaß gewesen? War ein Anlaß? Der polternde Preußenkönig hatte ihm, wie er jetzt in Ludwigsburg war, Vorstellungen gemacht. Er solle sich doch mit der Herzogin versöhnen, dem Land und sich einen zweiten Erben machen, sein Haus nicht auf die zwei Augen des Erbprinzen stellen, wo schon die Katholischen auf das Erlöschen der evangelischen Schwabenherzöge spitzten. Das war es nicht. Nein, das war es nicht. Soll sich der Preuße nach Haus scheren, zu seinem Sand und seinen Kiefern, mit seiner faden Nüchternheit und seinem kahlen, moralischen Sermon, der in jedem dritten Satz von Tod predigte. Er, Eberhard Ludwig, mit seinen Fünfundfünfzig, war Gott sei Dank noch in Saft und Schuß. Mag doch nach seinem Tod wer will das Land und seine Schulden auf den Buckel nehmen und sich mit dem lausigen Gesindel vom Parlament herumärgern. Darum der Christl den Abschied geben? Daß er ein Narr wäre!
Er nahm den Stapfschritt schneller, pfiff falsch und heftig eine Melodie aus dem letzten Ballett. Was hatte der Preuße weiter angeführt? Die Gräfin sei ein schlimmeres Unglück für das Herzogtum als alle Franzoseneinfälle und höchst beschwerlichen Reichskriege. Alle Drangsal, Jammer und Verwirrung in Württemberg, des sei sie Ursach und Stifterin. Sie schröpfe und quetsche gottserbärmlich, und aller Schweiß des Landes sei für ihre Taschen. Das kannte er. Kotz Donner! Die Melodie pfiff ihm aus hundert Schmähschriften entgegen, die Sauce servierten ihm seine Stände jede Woche zum Braten. Wenn Dürre war und Hagelschlag, war nicht auch daran die Frau schuld? Sollten froh sein, die Querulanten und filzig greinenden Pfeffersäcke, daß ihre lumpigen Batzen so prächtig in Glanz und Herrlichkeit umgemünzt wurden.Sie brauchte Geld, ja, ja, und immerzu, soviel Geld gab es im ganzen Römischen Reich nicht, wie sie brauchte, sie schmeichelte darum, bettelte, winselte, drohte, zürnte, schmollte, trotzte darum, es war oft ein Jammer und eine Verzweiflung, wenn er nicht wußte, woher mehr nehmen und immer mehr. Aber was war besser, die kahle, schäbige Haushälterei der Herzogin, wo kein Pfennig zuviel vertan wurde, oder der rauschende Glanz der Frau, wo die Schlösser und Forsten und alle Einkünfte der Kammer wie bunte Funken verprasselten?
Nein, mit solchen Argumenten konnte man ihm die Frau nicht verekeln. Er hatte auch dem Brandenburger fein heimgeleuchtet, und er wäre dem Grobian noch viel schwäbischer übers Maul gefahren, hätte er nur die paar tausend Soldaten mehr gehabt, die ihm seine Stände niemals, ach niemals verwilligen würden. Nein, das alles hatte ihm gar keine Impression gemacht, und wenn doch vielleicht der Knauser, der ungehobelte, den Anstoß zur Verabschiedung der Gräfin gegeben hatte, so war es mit etwas ganz anderem, mit einem viel leiseren Wort, auf das er wahrscheinlich selber kaum Gewicht gelegt hatte. Sie waren, der König und er, auf einen Aussichtspunkt hinaufgefahren, und wie der Brandenburger das weiche, wellige Land sah, die sanften, grünen, gesegneten Hügel mit Korn und Frucht und Wein und Forst, da hatte er vor sich hin geseufzt: »Wie schön! Wie schön! Und zu denken, daß ein altes Weib darüberliegt wie Meltau und
Weitere Kostenlose Bücher