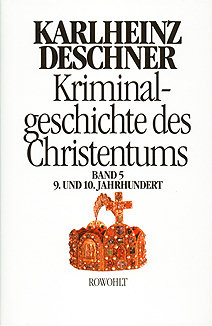![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Vertrauen auf Gott«. Der aber verließ ihn am 28. September 929. Darauf eilte der Brudermörder sofort nach Prag, bemächtigte sich des Thrones und ließ viele Anhänger Wenzels, zumal die diesem besonders ergebenen christlichen Priester, töten oder außer Landes jagen, falls sie sich nicht schon in Sicherheit gebracht. Zwar wollte Boleslav, ja selber Christ, nicht das Christentum in Böhmen beseitigen, doch sicher die von Wenzel gestützte deutsche Oberherrschaft. Er blieb, schreibt Bischof Thietmar, »voller Übermut lange Zeit aufsässig; schließlich warf ihn der König aber mannhaft nieder ...« 29
Schon bald nach seiner Ermordung wird Wenzel als Märtyrer verehrt, die offizielle Kanonisation indes erst im 17./18. Jahrhundert betrieben. Immer mehr wächst der Ruf von seiner Heiligkeit und den Wundern kraft seiner »Fürsprache«. Auch jenseits der Grenze verbreitet sich der Kult; weithin gibt es Wenzel-Reliquien in deutschen Landen. Die Hauptstücke aber befinden sich bis ins 20. Jahrhundert in Prag, das früh ganze Pilgerscharen heimsuchen, falls die alten Legenden wenigstens darin glaubhaft sind. Wenzel wurde jedenfalls einer der häufigsten Vornamen der Tschechen.
10. Kapitel
Otto I., »der Große« (936–973)
»...abgesehen vom Schrecken der königlichen Strafgewalt stets liebenswürdig.«
Mönch Widukind von Corvey 1
»Kaum wird ein Hirte wie er je wieder des Königtums walten! Neue Bistumssitze vermochte er sechs zu errichten. Kraftvoll gewann er den Sieg über Berengars schändlichen Hochmut. Auch der empörten Lombarden Nacken zwang er zu Boden ... Fernste Gestade entrichteten willig ihm ihre Tribute. Immer ein Friedensfürst ...«
Bischof Thietmar von Merseburg 2
»In der Gesinnung des christlichen Imperialismus hat Otto der Große seine Ostkriege geführt. Politik und Religion griffen so ineinander über, daß sie eine ›unlösliche Einheit‹ bildeten.«
Bünding-Naujoks 3
»Papst Johannes XIII. hat ihn 967 wegen seiner Leistungen für die römische Kirche in eine Reihe mit Konstantin dem Großen und Karl dem Großen gestellt.«
Helmut Beumann 4
»...von der Gesamtleistung her, die aus klar gesehenen Konzeptionen sowie wohldurchdachten und dann auch konsequent durchgeführten Situationslösungen resultierte, ist er ohne jeden Zweifel unter die Großen der Weltgeschichte einzureihen. Weiterführung und Ausgestaltung der beharrlichen Aufbauarbeit Heinrichs I. ist dabei nur das eine Signum seines Wirkens, das andere und wichtigere ist das aus seiner eigenen neuen Staatsidee sich entfaltende zielsichere Vordringen zu einer europäischen Hegemonie.« »Und er ist der einzige unserer mittelalterlichen deutschen Herrscher, dem die Geschichte den Beinamen ›der Große‹ auf Dauer bewahrt hat. Er hat sein Reich zur Hegemoniemacht in Europa erhöht.«
Eduard Hlawitschka 5
Zuerst das Schwert ...
Heinrich I., »der Vater seines Landes – größter und bester der Könige« (Widukind), hinterließ aus seiner zweiten Ehe mit Mathilde (S. 381) drei Söhne: Otto, Heinrich und Brun. Noch im Frühjahr hatte er auf der Reichsversammlung in Erfurt den Ältesten, den am 23. November 912 geborenen 24jährigen Otto offiziell zum Nachfolger designiert. Der ältere Thankmar, aus erster – ungültig erklärter – Ehe, war dabei ebenso übergangen worden wie der Zweitgeborene aus zweiter Ehe, Heinrich, Lieblingssohn der Königin Mathilde, den sie anscheinend lieber auf dem Thron gesehen hätte. So wurde – in einer für die deutsche Königskrönung traditionsstiftenden Zeremonie – Otto I. aus dem Sachsengeschlecht der Liudolfinger, der künftige erste deutsche Kaiser, am 7. August 936 in Lotharingien (das Ottos Vater dem Burgunderkönig Rudolf abgenommen) in der karolingischen Pfalz Aachen gesalbt und gekrönt. Danach endete der Tag mit dem rituellen »Krönungsmahl«, einer gewaltigen Freß- und Sauforgie (»wesentlicher Bestandteil aller Feierlichkeiten, bei denen der König zugegen war«: Bullough).
Zunächst aber hatten sich die drei rheinischen Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz wegen des Vorrangs beim Weihevollzug gestritten. Ruotbert von Trier, bald Erzkanzler/Erzkapellan, ehe er 956 an der Pest starb, insistierte auf dem höheren Alter seines Bischofssitzes sowie dessen Gründung »gleichsam durch den heiligen Petrus« (tamquam a beato Petro apostolo). Doch auch Wilfried von Köln wollte den Krönungsakt vornehmen. Zuletzt einigte man sich auf Hildebert von Mainz unter Assistenz des
Weitere Kostenlose Bücher