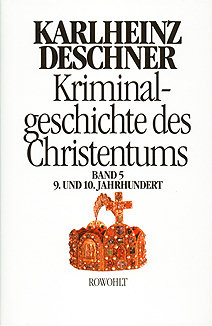![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
betend vor dieser »heiligen Lanze« zu Boden. Nach der Schlacht am 2. Oktober 939 gegenüber von Andernach kniet er weinend zu einem Dankgebet nieder. Auf wichtigen Kirchentreffen, der Generalsynode in Ingelheim 948, dem späteren Nationalkonzil in Augsburg, fordert er programmatisch das Christentum und seine Verbreitung und verspricht feierlich, jederzeit mit Herz und Hand für die Kirche zu kämpfen. Er zerstört heidnische Heiligtümer und errichtet christliche Missionsbasen, er sorgt für Missionare und schafft fest organisierte Diözesen. 967, auf der großen Reichs- und Kirchenversammlung von Ravenna, erstattet er Papst und Synodalen Bericht über seine »Missionstätigkeit« bei den Slawen.
Otto I. schloß also den traditionellen Bund der Karolinger mit der Kirche noch enger. Er und seine Nachfolger entwickelten die überlieferten Tendenzen fort. Er, Otto II. und Otto III., die sächsischen Kaiser, beherrschten wie niemand zuvor und danach die abendländische Kirche. Otto I. ließ Vorschriften gegen Geistliche verabschieden, die Jagd auf Wild oder Frauen machten, und gegen Laien, die Priestern die Zehnteinkünfte raubten. Er leitete Synodalversammlungen. Er zog 941 nach Würzburg und Speyer, 942 nach Regensburg, um dort an Bischofswahlen teilzunehmen. Und selbstverständlich entschieden die Ottonen über die Bischofssitze – wobei der Heilige Geist sich auffallend an die königlichen Verwandten erinnert: Otto macht seinen (außerehelichen) Sohn Wilhelm 954 zum Erzbischof in Mainz, seinen Bruder Brun 953 zum Erzbischof in Köln, seinen Vetter Heinrich 956 zum Erzbischof in Trier. Die Bischöfe Poppo I. und Poppo II. von Würzburg, Dietrich I. von Metz, Berengar von Verdun, Berengar von Cambrai, Liudolf von Osnabrück sind weitere königliche Verwandte. Ottos Tochter Mathilde wird, elfjährig, die erste Äbtissin von Quedlinburg.
Auch Päpste setzten die Ottonen ganz nach Gutdünken ein und ab. Otto I. entthronte Johann XII. und Benedikt V., Otto III. den Invasor Johann XVI. Ohne diese Eingriffe wären die kirchlichen Zustände Roms (S. 475 ff.) noch scheußlicher gewesen. Die katholischen Majestäten hatten von den »Stellvertretern Christi« auch keine allzu euphorischen Vorstellungen. Otto III. wies als erster die »Konstantinische Schenkung« (IV 14. Kap.) in aller Schärfe als Fälschung zurück.
Die Bischöfe – ein profitables Herrschaftsinstrument
Vor allem zog Otto I. die Bischöfe sowie Äbte der großen Reichsklöster an sich, um sie für den »Reichsdienst« einzuspannen. Die gewöhnlich dem Hochadel angehörenden maßgeblichen Kleriker kamen oft aus der Kapelle des Königs, wo sie ursprünglich (auch) geistliche Aufgaben wahrnahmen, jetzt aber geradezu für die Interessen des Herrschers herangebildet wurden. Unter Otto stammten die meisten Bischöfe in Sachsen, Franken und Bayern aus seiner Kanzlei und Hofkapelle. In den frühen 950er Jahren wurde die Zahl der Kapellane beträchtlich erhöht; seit den späteren 960er Jahren aber verdoppelte, ja verdreifachte sich der Personalbestand der zentralen Schaltstelle des Reiches. Wir kennen aus Ottos I. Regierungszeit immerhin 45 Hofgeistliche, davon etwas mehr Säkularkleriker als Mönche. Und wie schon unter den Karolingern fungieren sie als seine Berater, seine Diplomaten, Verwaltungsfachleute, Feldherren.
Denn selbstverständlich zogen die zumeist in der Hofkapelle »auf Reichstreue und vertieftes Verständnis des Christentums (!) hin ausgebildeten Bischöfe und Reichsäbte« (Hlawitschka) auch mit in den Krieg. Zum Beispiel befanden sich auf Ottos Zug nach Frankreich im Herbst 946 in seinem Heer, welches das gesamte Gebiet bis zur Loire und die Normandie mit ausgedehnten Plünderungen heimsuchte, die Metropoliten von Mainz, Trier, Reims nebst weiteren Seelenhirten. Die Trierer Erzbischöfe agieren 946 und 948 als Befehlshaber auch im Süden, sind dort aber zwischen 953 und 965 ebenfalls auf Heereszügen. Bischof Dietrich von Metz – dessen Vorgänger Adalbero, mehrfach an Kriegen beteiligt, vermutlich auch schon in Italien operierte – war dort unter Otto I. fünf Jahre ununterbrochen. Fast ebenso lang Erzbischof Adaldag von Hamburg, der die ottonische Reichs- und Kirchenpolitik stark beeinflußt und später mit Hilfe von Ottos II. dänischem Krieg (974) auch in Skandinavien die Frohe Botschaft verbreitet hat und sein »vertieftes Verständnis des Christentums«, das auch er sicher in der Hofkapelle, zeitweise sogar als Kanzler Ottos,
Weitere Kostenlose Bücher