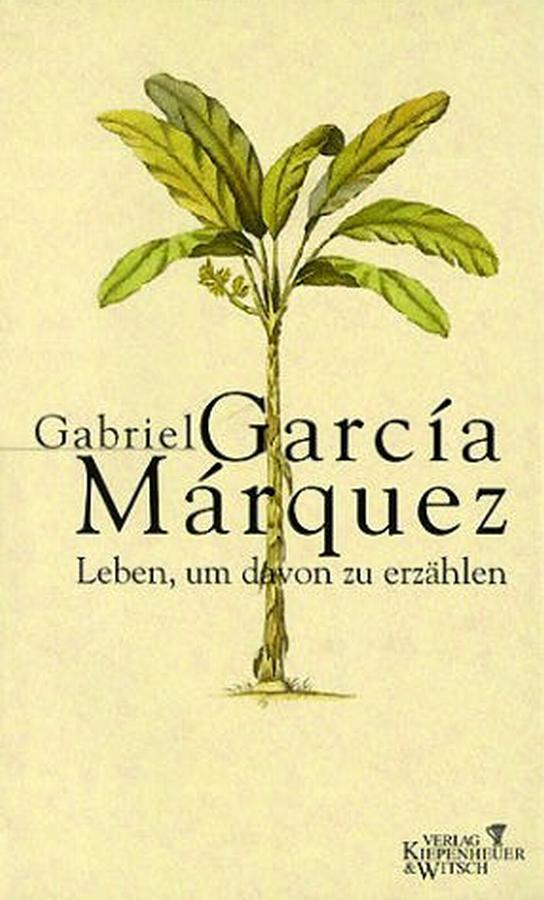![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
Ergebnissen, hielten mich nicht nur für einen tadellosen Schüler, sondern auch für einen vorbildlichen Freund, für den Intelligentesten und Schnellsten, der berühmt war für seinen Charme. »Der perfekte kleine Junge«, wie meine Großmutter sagte.
Um es schnell abzuschließen: Die Wahrheit sah ganz anders aus. Ich hatte diesen Eindruck erweckt, weil ich nicht so mutig und selbständig wie mein Bruder Luis Enrique war, der nur das tat, wozu er Lust hatte. Und der zweifellos eine
Art von Glück verwirklichen würde, nicht das, welches Eltern für ihre Kinder ersehnen, aber doch das Glück, das Kindern erlaubt, die unmäßige Zärtlichkeit, die irrationalen Ängste und die übermütigen Hoffnungen der Eltern zu überleben.
Meine Mutter war niedergeschmettert von dem Bild, das so gar nicht dem entsprach, was sie beide sich in ihren einsamen Träumen ausgemalt hatten.
»Ich weiß nicht, was wir tun sollen«, sagte sie nach einem tödlichen Schweigen, »wenn wir das alles deinem Vater erzählen, stirbt er auf der Stelle. Merkst du denn nicht, dass du der Stolz der Familie bist?«
Für die beiden war es ganz einfach: Da für mich nicht in Frage kam, dass ich der bedeutende Arzt wurde, der mein Vater mangels Geld nicht hatte werden können, träumten sie zumindest davon, dass ich irgendeinen anderen akademischen Beruf ergriff.
»Ich werde aber nichts von alledem«, schloss ich. »Ich lasse mich nicht zu etwas machen, was ich nicht sein will, nur weil ihr es euch wünscht oder gar, weil die Regierung es will.«
Der Disput zog sich wie ein Blindekuhspiel über den Rest der Woche hin. Ich glaube, dass meine Mutter sich Zeit nehmen wollte, um mit meinem Vater darüber zu sprechen, und das gab mir neuen Mut. Eines Tages kam sie wie zufällig mit einem überraschenden Vorschlag:
»Es heißt, du könntest ein guter Schriftsteller werden, wenn du dir das vornimmst.«
So etwas hatte ich in meiner Familie noch nie gehört. Meine Neigungen hatten seit meiner Kindheit vermuten lassen, dass ich Zeichner, Musiker, Kirchensänger und sogar Sonntagsdichter werden könnte. Inzwischen hatte auch die Mutter meinen allgemein bekannten Hang zum eher geschraubten und ätherischen Schreiben entdeckt, nun aber reagierte ich verblüfft.
»Schriftsteller? Da müsste man schon einer der Großen werden, und die werden heute nicht mehr gemacht«, antwortete ich meiner Mutter. »Zum Verhungern gibt es schließlich bessere Berufe.«
An einem jener Nachmittage redete sie nicht mehr mit mir, sondern weinte trockene Tränen. Heute hätten bei mir die Alarmglocken geschrillt, denn ich halte das unterdrückte Weinen für ein unfehlbares Mittel großer Frauen, um ihre Absichten durchzusetzen. Doch mit achtzehn wusste ich nicht, was ich meiner Mutter sagen sollte, und mein Schweigen störte ihre Tränen.
»Nun gut«, sagte sie daraufhin, »versprich mir wenigstens, dass du das Abitur so gut wie möglich schaffst, und ich übernehme es dann, den Rest mit deinem Vater zu regeln.«
Beide hatten wir gleichermaßen das erleichterte Gefühl, gewonnen zu haben. Ich ging auf den Vorschlag ein, sowohl ihr als auch meinem Vater zuliebe, denn ich fürchtete, die beiden könnten sterben, wenn wir nicht bald zu einem Einvernehmen kämen. So fanden wir die einfache Lösung, ich solle Jura und Politische Wissenschaften studieren, was nicht nur eine gute Bildungsbasis für jedweden Beruf war, sondern auch einen humanen Studienplan versprach, Vorlesungen am Vormittag und freie Zeit am Nachmittag, um zu arbeiten. Besorgt über die emotionale Last, die meine Mutter in jenen Tagen allein hatte tragen müssen, bat ich sie, das Terrain vorzubereiten, damit ich Aug' in Auge mit Papa sprechen konnte. Sie sperrte sich dagegen, da sie davon überzeugt war, dass es in einem Streit enden würde.
»Es gibt auf dieser Welt keine zwei Männer, die sich so sehr ähneln«, sagte sie. »Und das ist eine schlechte Voraussetzung für so ein Gespräch.«
Ich hatte immer das Gegenteil geglaubt. Erst jetzt, da ich bereits alle Altersstufen durchschritten habe, die mein Vater in seinem langen Leben hinter sich gelassen hat, sehe ich in den Spiegel und bin ihm ähnlicher als mir selbst.
Meine Mutter muss an jenem Abend die Feinarbeit eines Goldschmieds vollbracht haben, denn mein Vater versammelte die ganze Familie um den Esstisch und verkündete scheinbar gelassen: »Wir werden einen Rechtsanwalt im Haus haben.« Womöglich voller Angst, dass mein Vater die Debatte vor der ganzen
Weitere Kostenlose Bücher