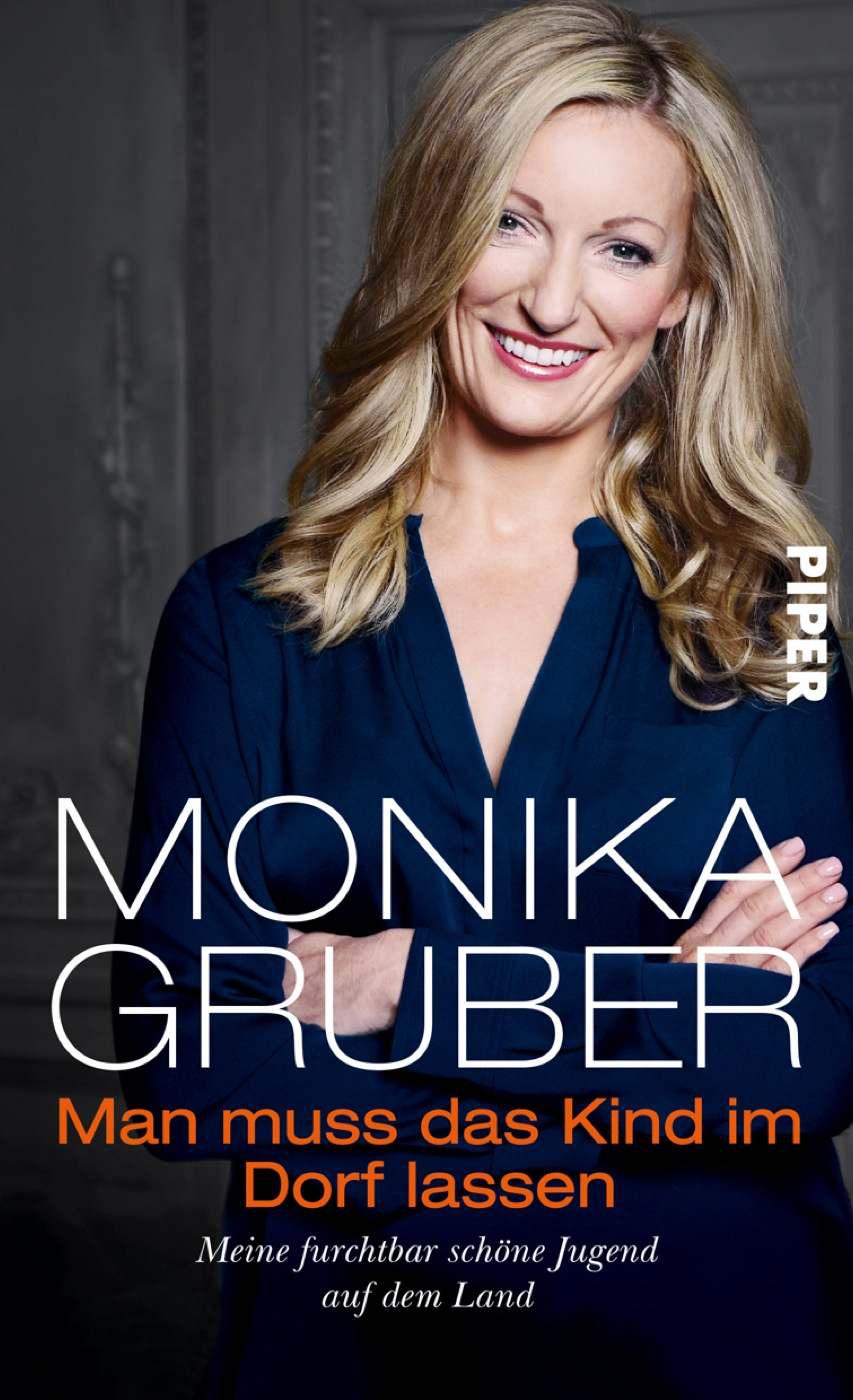![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
Antibabypillen auf einen Sitz auffraß. Das war natürlich eine gnadenlose Übertreibung um eines billigen Lachers willen, aber unsere Eltern hätten eben auch nie zugelassen, dass wir Kinder uns so aufführten. Und dazu mussten sie nicht einmal die Stimme heben, es genügte schon, wenn meine Mutter lediglich die linke Augenbraue leicht hob, dann wussten wir genau: »Au weh, jetzt heißt’s brav sein!«
Außerdem mussten wir allein deshalb schon still sein, weil sich meine Eltern in der knapp bemessenen Freizeit, die sie hatten, unterhalten wollten. Miteinander. Nicht mit uns. Uns störte das aber nicht weiter, denn wir waren mit dem Festessen beschäftigt, das es daheim nie gab: Pommes, die wir mit den Fingern essen durften, weil es dann leichter war, den glibberigen Ketchup so zu balancieren, dass er im Mund und nicht auf dem Feiertagsgewand oder der Tischdecke landete.
Und wenn wir dann nach der Brotzeit aus München hinausfuhren, durch die flache, spärlich bewaldete Landschaft des Erdinger Moos, und uns schließlich dem Ortsschild von Tittenkofen näherten, von wo aus man bereits die hügeligen Ausläufer des Holzlandes erkennen konnte, dann stellte sich immer unmittelbar – spätestens, wenn wir bei uns durch die Hofeinfahrt fuhren – das wohlige Gefühl des Heimkommens ein. Und fast jedes Mal, wenn meine Mama in der Garage aus dem Auto stieg, sagte sie seufzend: »Mei, auf d’Nacht is’ ma einfach froh, wenn ma wieder heimkommt!« Vier Stunden waren ja auch ein ziemlich langer Ausflug.
Aber tatsächlich verbinde ich den Begriff Heimat in erster Linie mit Gerüchen, den Gerüchen meiner Kindheit: dem Duft von fast trockenem Heu, das in der flirrend heißen Sommerluft gewendet wird, von herbstlichen Maisfeldern, die gerade abgedroschen werden … irgendwie leicht grasig-säuerlich, aber auch satt und sonnengereift. Und dazu die letzten Herbststrahlen einer späten Nachmittagssonne, die nicht mehr so recht Kraft hat und bald der stechend kühlen Novemberluft und dem über Wochen undurchdringlichen Nebel des Erdinger Moos weichen wird. Der ganz spezielle Geruch unseres Hausflurs daheim (der »Flez«) erinnert mich sofort an die Spiele unserer Kindheit, als mein Bruder seine dreckigen Spielzeugtraktoren mit Anhänger voller Maiskolben, Sämaschinen und überhaupt sein ganzes Glump in unserer Flez vor dem angekündigten Regen in Sicherheit brachte, sodass man sich trotz der stattlichen Größe unseres Hausflurs kaum noch umdrehen konnte, ohne über einen Pflug oder ein halb mit Regenwasser gefülltes Odelfassl zu stolpern.
Der Geruch in der Küche meiner Mutter, der ganz eigen war und vor allem appetitanregend. Dieser Duft lässt einen sofort hungrig werden, wenn man von der Flez aus in die Küche kommt, denn die Luft duftet immer so, als sei sie mit einem Hauch von Butterschmalz und Puderzucker und einer leichten Bratensoßennote versetzt.
Der Geruch von Wäsche, die auf der Leine an der frischen Luft getrocknet worden ist. Dieser Geruch ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Vor allem, wenn die Mama vergessen hat, dass der Babba auf dem Feld nebenan Gülle gefahren hat, sodass die ganze Wäsche nach Odel roch und in der Schule wieder keiner neben mir sitzen wollte … ah, ich sage es Ihnen: unvergleichlich!
Und dass Heimat wenig Gred bedeutet, heißt nicht, dass es wenig Klatsch und Tratsch gibt. Um Gottes willen: Klatsch hält die Gesellschaft zusammen wie die Mehlschwitze die Soße in einer Betriebskantine. Der Bayer redet ja in der Regel eher wenig – Barbara Schöneberger, mein Vater und ich sind die großen Ausnahmen –, aber mit diesem wenigen ist alles gesagt.
In einer meiner Münchner Lieblingsgaststätten, Beim Sedlmayr, habe ich einmal folgende Szene beobachtet: Ein junger Kerl Anfang dreißig, Typ Investment-Hedgefonds-Wealth-Manager-Banker im gut geschnittenen Anzug mit dunkler Krawatte und mit Sonnenbrille im Haar, kommt lässig in das Lokal gewackelt. Seine Lässigkeit verfliegt allerdings sogleich, als er sich umsieht und feststellt, dass im ganzen Lokal nur noch ein Stuhl frei ist: an einem Tisch, an dem sechs waschechte Münchner Mannsbilder (also kein Trachtenanzug) im Alter von Ende sechzig bis Mitte siebzig hocken. Die gut gelaunten Herren benehmen sich so, wie man sich an einem Ort benimmt, der einem sehr vertraut ist: eben mit einer natürlichen Entspanntheit. Man ist so ungefähr beim zweiten Weizen, bevor man sich später eine kleine Portion Tellerfleisch oder saure
Weitere Kostenlose Bücher