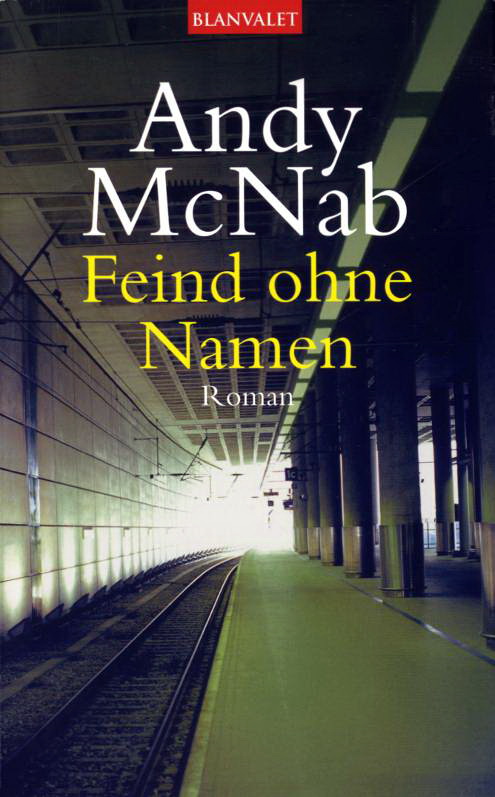![Nick Stone 06 - Feind ohne Namen]()
Nick Stone 06 - Feind ohne Namen
sehr frustriert, was die gesamte Kelly-Situation betraf. Er bremste die Kinder etwas, damit wir nicht zu dritt fortgeschwemmt wurden. »Ich versuche, sie zum Reden zu bringen, aber ich erwische einfach nicht die besten Tage. Manchmal ist es echt schwierig, an sie ranzukommen.« Er fuhr sich mit der Hand über sein schütteres Haar und betrachtete dann seine Finger, als erwarte er, weitere ausgefallene Haare an ihnen zu sehen. Er war erst Ende dreißig, schien aber bereits auf dem Rad des Lebens gebrochen zu sein. »Sie wissen beide, wie sie sein kann: heute mürrisch in sich gekehrt, morgen in strahlend guter Laune, übermorgen wieder abweisend. Das muss man erst mal verkraften. Die Schulpsychologin würde ihr gern helfen, aber ... ah, da sind wir. Ich musste sie gleich zum Direktor schicken. Wir dürfen im Unterricht keine Disziplinlosigkeit durchgehen lassen. Wir sind da, hier herein.«
Er öffnete die Tür zum Wartezimmer des Direktors. »Kelly, sieh mal, wer ... Oh ...« Neben dem Stuhl, auf dem Kelly hätte sitzen sollen, stand ein halb voller Pappbecher mit Wasser, aber das war’s auch schon. Der Raum war leer.
»Sie ist vor einer Stunde abgehauen.« Die Sekretärin des Direktors war eine große Schwarze, die Effizienz ausstrahlte, aber trotzdem außerstande war, ihre Besorgnis zu verbergen. »Der Direktor hat versucht, Sie telefonisch zu erreichen, Mr. d’Souza. Wir wollten schon die Polizei rufen.« Die Schulsekretärin schüttelte den Kopf. »Beim Hereinkommen hat sie nur gesagt, sie wolle nach Disneyland.«
»Du lieber Gott.« Josh seufzte, als er sich mir zuwandte, und machte eine resignierte Handbewegung. Er zog sein Handy heraus, tippte eine Kurzwahlnummer ein, hielt das Gerät ans Ohr und ließ es gleich wieder sinken. »Ihr Handy ist ausgeschaltet. Okay, wir fahren wieder nach Hause. Ist sie nicht dort, müssen wir die Polizei verständigen.«
»Nicht nötig, Kumpel.« Ich ging zu dem Dodge voraus. »Ich weiß genau, wo sie jetzt ist.«
7
Wir fuhren nach Westen und folgten dabei den Wegweisern nach Baltimore und Washington. Josh hatte schon dreimal bei sich zu Hause angerufen, aber dort ging niemand ans Telefon. Wenig später benutzten wir die Zufahrtsrampe auf die I-95 in Richtung Washington. »Disneyland, was? So nennt sie ihr altes Haus?«
»Manchmal.«
Er zuckte mit den Schultern. »Hab ich dir schon erzählt, dass sie nicht mehr mit uns in die Kirche geht? Sie bezeichnet Religion als Schwindel. Ich denke nicht mal, dass sie das wirklich glaubt - das sagt sie nur, um uns wehzutun.«
»Du weißt, wie sie dazu steht, Kumpel. Wenn’s einen Gott gibt, wie kommt’s dann, dass ihre Familie tot ist?«
Josh schüttelte den Kopf. »Darüber will ich jetzt nicht diskutieren - und dir rate ich dringend, die Heilige Schrift zu lesen.«
Ich starrte die Mittelkonsole an. Der Puertoricaner in ihm zeigte sich in einem neueren Foto von Kelly und seinem Dreigespann in einem kleinen, aber reich verzierten Goldrahmen. Dakota war jetzt sechzehn und hatte die Mutter aller Zahnspangen im Mund. Kimberly war vierzehn und hatte nur eine Sorge im Leben: ihr prachtvolles Haar. Und Tyce, der Junge, war dreizehn und hielt sich für Tony Hawks. Alle drei hatten einen helleren Teint als ihr Vater, weil ihre Mutter eine Weiße war, aber sie sahen Josh sehr ähnlich. In ihrem Haus
konnte man sich vor lauter gerahmten Fotos kaum bewegen. Sie zeigten Josh, als er noch Haare hatte, als jungen Soldaten, der wie die Jungs in den Wohnzimmerfenstern der Nachbarn aussah; Josh als Offizier der Special Forces; Josh und die Kinder; Josh, Geri und die Kinder. Dazu kamen all die grässlichen Schulfotos von Kindern mit Zahnlücken und verschorften Knien.
Josh merkte offenbar, dass ich nicht freiwillig auspacken würde, deshalb hielt er mir als guter Christ auch die andere Wange hin. »Also, erzähl schon, Mann, was machst du in letzter Zeit?«
»Oh, mir geht’s gut. Neulich habe ich ein paar Wochen in England gearbeitet. War richtig komisch, bei der Einreise mit anderen Ausländern anzustehen. Aber von irgendwas muss man schließlich leben.« Das erinnerte mich daran, weshalb ich ihn ursprünglich hatte aufsuchen wollen. Ich zog den noch immer zugeklebten Umschlag aus meiner Bomberjacke und schob ihn unter Joshs rechten Oberschenkel. »Kauf dir ein vernünftiges Auto, ja? Und ein Toupet.«
»Danke. Aber ich weiß eine bessere Verwendung dafür, denke ich.«
Das glaubte ich sofort. Kelly war nicht die Einzige, die das Geld
Weitere Kostenlose Bücher