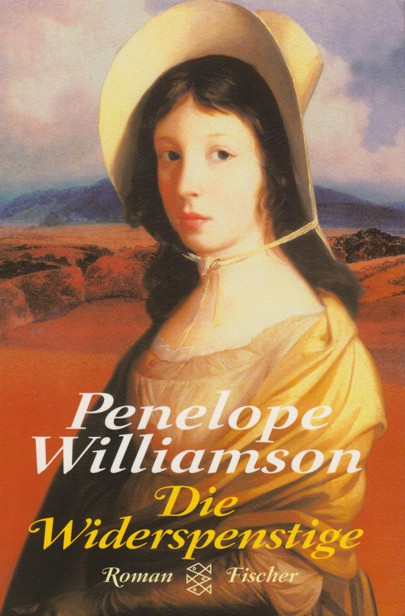![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
widerstehen.
Weiß Gott, dachte er mit einem freudlosen inneren Lachen, ich bin
nicht zur Selbstaufopferung geschaffen.
Er dachte daran, nach Norridgewock zu gehen. Aber er würde es
nicht tun. Die Erinnerungen an Delia und an ihre Liebe waren dort zu
schmerzlich, und der Weg zu ihr zurück war zu einfach. Er würde noch eine
Weile dem Fluß folgen und dann nach Westen ziehen. Assacumbuit hatte ihm einmal
gesagt, das Land, das die Yengi »Amerika« nannten, erstrecke sich nach
Westen bis zum Rand der Welt, bis an ein anderes Meer, wo die Sonne nachts
schlafen ging. Er wollte einfach geradeaus gehen, bis er das Ende der Welt
erreichte. Dort würde er allein sein mit seinen Gedanken an sie, seinen
Träumen und seinen Erinnerungen.
An der Stelle, wo sich der Fluß teilte, machte
er Rast, obwohl er keineswegs müde war. Als Junge hatte
Assacumbuit ihn mehrmals gezwungen, einen Tag und eine Nacht, ohne Wasser oder
Rast zu laufen. Als Zwölfjährigen hatte man ihn einmal nackt und ohne alles,
sogar ohne Messer in den Wald geschickt. Eine Woche später war er
zurückgekommen – bekleidet und so gut genährt, daß er seinem Vater Fleisch als
Geschenk mitbrachte. Schließlich war er im Alter von sechs Jahren von Kittery
bis Quebec marschiert und hatte dabei einen Packen auf dem Rücken getragen,
der so groß war wie er selbst. Der Marsch hatte seinen Körper abgehärtet und
seinen Geist ebenfalls. Er hatte schon öfter geliebte Menschen verloren und
den Verlust überlebt.
Und auch das werde ich überleben, sagte er sich. Ich muß es. Das
Leben hat mich immer und immer wieder gelehrt, daß ein Mann ertragen kann, was
er ertragen muß, und danach weitermacht.
Er setzte sich auf einen Felsen am Ufer und nahm die Büchse auf
den Schoß. Die Sonne war wie eine warme Liebkosung auf seinem Gesicht. Eine
frische Brise kräuselte die Wasseroberfläche und spielte in den Zweigen wie auf
einer Harfe. Sie trug den Geruch von Fett und schlecht gegerbten Häuten mit
sich.
Es kam jemand.
Es waren zwei Personen, und wer immer sie waren, sie machten kaum
Lärm. Aber Krieger der Abenaki hätten überhaupt keine Geräusche gemacht. Also
mußten es Trapper sein. Es fragte sich, ob sie Engländer und vermutlich
freundlich oder Franzosen und wahrscheinlich weniger freundlich waren.
Langsam und gelassen lud Tyl seine Büchse. Er legte sie quer auf
seine Schenkel, hielt den Finger am Abzug und wartete.
Nicht lange danach tauchten sie an einer Flußbiegung auf: Jefferson
und seine junge Squaw. Sie ging tief gebeugt unter der Last von Häuten auf
ihrem Rücken, unter der sie praktisch verschwand. Jefferson trug nichts außer
seiner Büchse. Als er Tyl entdeckte, lachte er und entblößte seine Zahnlücken.
»Sie jagen ziemlich weit weg von zu Hause, Doc, wie?« rief er, als
er in Hörweite kam.
Tyl wartete, bis der alte Trapper auf
gleicher Höhe war.
»Es sieht so aus, als hätten Sie einen guten Winter gehabt, Jefferson«,
sagte er und wies mit dem Kinn auf die Biberfelle. Die junge Frau blickte
stoisch geradeaus, aber Tyl sah, daß ihr der Tragegurt tief in die Haut auf
der Stirn schnitt. Wenigstens litt sie nicht mehr an Skorbut.
»Wir sind auf dem Weg zu Mrs. Susans
Handelsposten in der Nähe von Falmouth. Haben Sie schon gehört, daß sie
heiraten will?«
»Nein. Wen denn?« fragte Tyl, den es im Grunde
nicht interessierte.
Jefferson zuckte die Schultern. »Einen Kerl aus Wells. Er soll
Küfer sein.« Er fuhr sich mit den Fingern durch den Bart und betrachtete Tyl
aufmerksam. Sein nicht sehr sauberes Gesicht verzog sich plötzlich
nachdenklich, und er runzelte angestrengt die Stirn. Ȇbrigens, ich soll Ihnen
etwas ausrichten. Aber was ... hm, ach jetzt fällt es mir wieder ein. Die
Indianer haben Nat Parker nicht umgebracht und skalpiert. Es war irgendein
anderer.«
Tyl seufzte. »Das weiß ich schon. Trotzdem
vielen Dank.«
Jefferson stellte fest, daß Tyl seine Squaw forschend ansah.
»Nesoowa ist seit dem Tag in Falmouth Neck völlig in Ordnung, Doc. Ich habe sie
den ganzen Winter lang mit Sprossenbier abgefüllt, stimmt's?« Er lächelte die
junge Indianerin liebevoll an. Sie warf Tyl einen scheuen Blick zu und schob
den Packen auf ihrem Rücken höher.
»Könnten Sie die Last nicht wenigstens mit
ihr teilen?« fragte Tyl.
»Was?«
»Ob Sie ihr nicht helfen können, die Felle zu
tragen.«
»Warum?«
Tyl seufzte.
Jefferson fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Sie haben
nicht zufällig ein bißchen Maisschnaps
Weitere Kostenlose Bücher