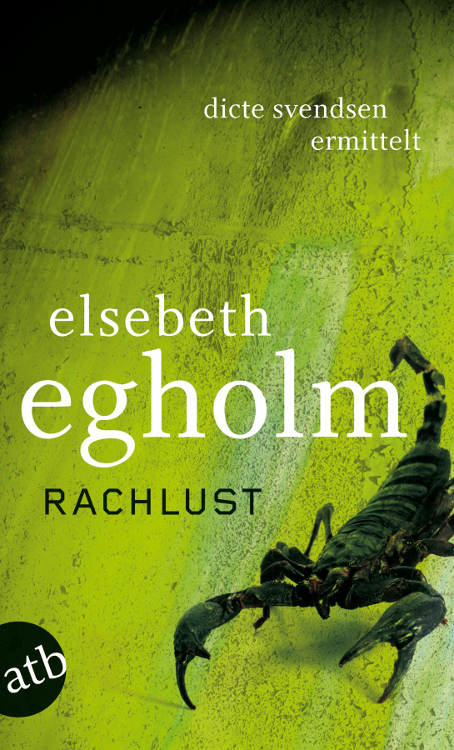![Rachlust - Dicte Svendsen ermittelt]()
Rachlust - Dicte Svendsen ermittelt
Zeit?«
Wagner war sich durchaus bewusst, dass er die Unterhaltung allein führte und Ida Marie vollkommen verstummt war. Er empfand es als seine Pflicht, so viel Klarheit wie möglich zu schaffen.
»Sie haben etwa eine Woche Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Der Abort muss dann innerhalb einer Woche erfolgen.«
»Es muss weggemacht werden.«
Es wurde ganz still im Raum. Ida Marie wiederholte die Worte mit einem Nachdruck, der Wagner überrumpelte.
»Es muss weggemacht werden. Wir können das Leben mit einem behinderten Kind nicht bewältigen.«
Sie sah ihn mit trockenen, müden Augen an. »Wir können das Martin gegenüber nicht verantworten. Und schon gar nicht Alexander.«
Der Tag zog sich schleppend dahin. Ida Marie insistierte darauf, zur Arbeit zu gehen, und benahm sich auf einmal so normal, dass er ganz misstrauisch wurde. Auch er war genötigt, zu einem Termin zu erscheinen, fühlte sich aber mehr tot als lebendig, als er mit Ivar K in die Auffahrt der Villa in Skødstrup fuhr, wo der Vizevorsitzende des Dachverbands »Seltene Krankheiten«wohnte. Er hatte die Liste der Krankheiten überflogen, die vom Verband betreut wurden, und fühlte sich plötzlich wie ein Mitglied der Zielgruppe. Allerdings zählte das Down-Syndrom nicht dazu, wahrscheinlich galt das nicht einmal als eine Krankheit im klassischen Sinne.
Henrik Laurvig war Arzt. Der Vorsitzende wohnte in Kopenhagen, und Adda Boel hatte am meisten mit ihm zu tun gehabt.
Laurvigs Haus lag in einer ruhigen Wohnstraße in der Nähe einer Schule und diverser Einkaufsmöglichkeiten. Ein ganz durchschnittliches dänisches Einfamilienhaus mit Zweitwagen der Frau in der Garage und einem schwarzen Labrador, der sie wedelnd an der Seite seines Herrchens begrüßte, das wie sein Hund die Freundlichkeit in Person war.
Sie wurden zu Kaffee und Gebäck eingeladen und durften sich in weichen Möbeln im Kaminzimmer niederlassen, wo das Feuer um ein paar Scheite tanzte. Auf den Terrakottafliesen lagen gemusterte Teppiche, und die offene Küche ging in das Wohnzimmer über, so, wie es sich gehörte.
»Ja, das mit Adda ist eine schreckliche Geschichte. Wir waren schockiert, aber das versteht sich ja von selbst.«
Er war ein kleiner, kompakter Mann, seinem Hund nicht unähnlich, der sich auf einen der Teppiche am Kamin gelegt hatte. Sie hatten auch denselben Gesichtsausdruck: eine Mischung aus Traurigkeit und Fröhlichkeit, unter der eine gewisse Nervosität schwang. Wie immer, wenn Menschen Besuch von der Polizei bekamen.
»Aber Sie glauben doch nicht, dass Addas Tod etwas mit ihrer Krankheit zu tun hat? Soweit ich das verstanden habe, wurde sie von einem Einbrecher erwürgt.«
»Das ist reine Routine«, beschwichtigte Ivar K ihn und ließ seinen Körper in einen der tiefen Sessel sinken. »Wir versuchen eine Bestandsaufnahme ihres Lebens zu machen, und Sie sind ein kleines Puzzlestück in diesem großen Bild.«
Henrik Laurvig schien sich dank dieser Worten ein wenig zu entspannen.
»Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen von Ihrem Verband erzählen?«, schlug Wagner vor, um den Mann auf vertrautes Terrain zu führen. »Wir sind in diesem Bereich ja vollkommen unbewandert.«
Sie bekamen eine, wie Wagner fand, kurze Version des Standardvortrags geboten. Der Dachverband bestehe aus über dreißig verschiedenen Unterorganisationen, die alle eine seltene Krankheit repräsentierten. Auf diese Weise war er Sprachrohr für Menschen, die an Krankheiten litten, die sonst wenig Beachtung fanden, weder vonseiten der Politik, der Gesellschaft noch des Gesundheitssystems. Ziel sei unter anderem, Druck zu erzeugen, damit die Kranken schneller eine Diagnose gestellt bekämen – immer wieder mussten sie aufgrund von Unwissenheit ungebührlich und nervenaufreibend lange warten –, ferner wolle man die Forschung im Bereich der selteneren Krankheiten vorantreiben und einen besseren Überblick im Patientenverlauf gewährleisten.
»Die meisten Betroffenen erleben die Sachbearbeiter der Gemeinden als unzulänglich«, sagte Laurvig. »Sie werden von Büro zu Büro geschickt, müssen sich immer wieder mit neuen Mitarbeitern auseinandersetzen, ohne dass einer von ihnen zum Beispiel eine Haushaltshilfe bewilligt oder ein zusätzliches Hilfsmittel wie einen Rollator oder ein Spezialpflegebett.« Laurvig hatte sich warmgeredet. »Besonders für die Eltern von Kindern, die an diesen Krankheiten leiden, sind das traumatische Erfahrungen. Denn sie haben keine
Weitere Kostenlose Bücher