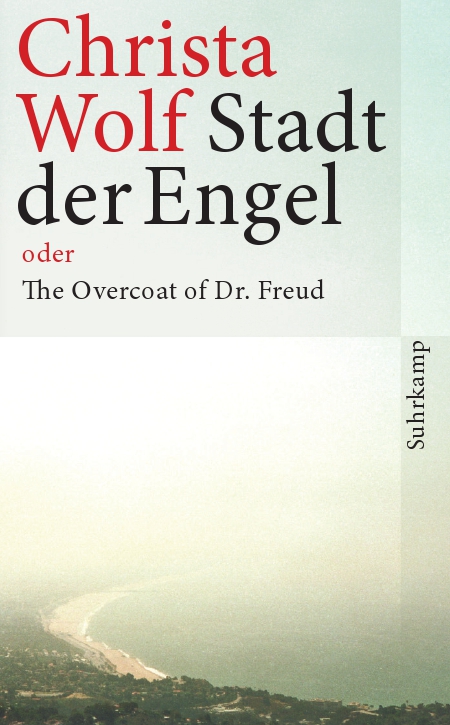![Stadt der Engel]()
Stadt der Engel
ihre Studien über eine antike Figur im berühmten Museum des CENTER abzuschließen. Sie hatte mir meine Tasse hingestellt, die Thermoskanne mit Tee in Reichweite, die deutsche Zeitung, die man hier abonniert hatte, auch. Ich bedankte mich bei ihr mit einem Blick. Mit ihrem braunen lockigen Haar und der in allen Farben zusammengesetzten Patchwork-Jacke war sie wieder einmal besonders schön. Wie immer, wenn wir uns begegneten, strahlte sie mich entzückt an. Ich goß mir also Tee ein, entfaltete meine Zeitung und las, was vor drei, vier Tagen in Deutschland des Berichtens für wert befunden worden war. Las also, daß ein Kollege, der unser Land wenige Jahre vor dessen Zusammenbruch hatte verlassen müssen, aber doch etwas wie ein Gesinnungsgenosse gewesen war, sich nun als radikaler Kritiker zeigte all derer, die in der DDR geblieben waren, anstatt dieses Land ebenfalls mit Abscheu zu verlassen. Ich las, er warf der »Revolution« vom Herbst 1989 vor, daß sie unblutig verlaufen war. Köpfe hätten rollen müssen, las ich, und daß wir zu zaghaft und zu feige gewesen seien. Das schrieb einer, dessen Kopf jedenfalls nicht in Gefahr gewesen wäre, dachte ich, und ich merkte, wie ich in meinem Innern eine Diskussion mit diesem Kollegen anfing.
Ich erinnerte mich – und erinnere mich noch heute – an deine Erleichterung, als dir am Morgen des 4. November 1989 rund um den Alexanderplatz in bester Stimmung die Ordner mit den orangefarbenen Schärpen entgegenkamen, auf denen stand: KEINE GEWALT! In der Nacht davor wurde bei einemTreffen, an dem du teilnahmst, das Gerücht verbreitet, Züge mit als Arbeiter verkleideten Stasi-Leuten seien in Richtung Hauptstadt in Fahrt gesetzt, um die friedlich Demonstrierenden zu provozieren und den bewaffneten Kräften einen Vorwand zum Eingreifen zu liefern. Eine Art Panik ergriff dich, du riefst die Tochter an, sie möge die Kinder nicht mit auf den Alexanderplatz bringen, aber die hatten längst ihre Transparente gemalt: SCHULE WERDE SPANNENDER! und GORBI HILF UNS!, und sie würden nicht mehr zurückzuhalten sein. Du gingst deine Rede Wort für Wort noch einmal durch. Ihr spracht nicht davon, aber ihr dachtet an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Die Vorstellung, ihr könntet zu naiv, zu leichtfertig in eine Falle gelaufen sein, lastete auf dir, aber je mehr Demonstranten aus den U-Bahnschächten auf den Platz strömten, ihre Transparente und Schilder aufrichteten, sich zum Demonstrationszug formierten, ohne Anweisungen zu brauchen, um so sicherer warst du, daß nichts passieren würde. Du konntest nicht wissen, ihr alle wußtet nicht, daß auf den Dachböden öffentlicher Gebäude Unter den Linden kompanieweise Volksarmee stationiert war, mit scharfer Munition. Für den Ernstfall. Falls die Demonstranten die vereinbarte Route verlassen und zum Brandenburger Tor durchbrechen sollten, zur Staatsgrenze West. Und was du erst später erfuhrst: daß einer der Söhne einer Kollegin dort oben in Uniform auf einem der Dachböden lag, während der andere im Demonstrationszug unten vorbeizog.
Aber hätten die Soldaten überhaupt geschossen? Einige Monate nach diesem Tag, die Grenzen waren längst offen, die Hochstimmung war verflogen, die Realität, die anscheinend immer ernüchternd sein muß, war auf dem Vormarsch, gingst du mit Einkaufsbeuteln bepackt in deinem Stadtviertel nach Hause, als ein jüngerer Mann dir nachlief und dich dringlich bat, mit ihm und zwei seiner Kameraden, alle drei Offiziere der Nationalen Volksarmee in Zivil, einen Kaffee zu trinken. Ihr saßet in einem Vorgartencafé, es müssen die ersten wärmerenTage gewesen sein, die drei hatten bis zum Fall der Mauer die Staatsgrenze West bewacht, von der sie nun, da sie dort nicht mehr gebraucht würden, abgezogen worden seien, um an die polnische Grenze verlegt zu werden, was sie aber auf keinen Fall wollten, da sie ihre Familien, ihre Wohnungen oder kleinen Häuschen hier in Berlin hätten, und überhaupt: Die Truppe werde reduziert. Was dann mit ihnen werden solle. Wo sie doch mit dafür gesorgt hätten, daß in der Nacht vom 9. November an der Mauer kein Schuß gefallen sei. Sie, ein Hauptmann und zwei Leutnants, hätten, als die Massen auf die Grenzübergänge zugeströmt seien und sie keinen Vorgesetzten erreichen konnten, der ihnen Befehle erteilt hätte – sie hätten da bei ihrer Einheit die Munition eingesammelt, damit ja nichts passieren konnte. Warum sie das gemacht hätten, fragtest
Weitere Kostenlose Bücher