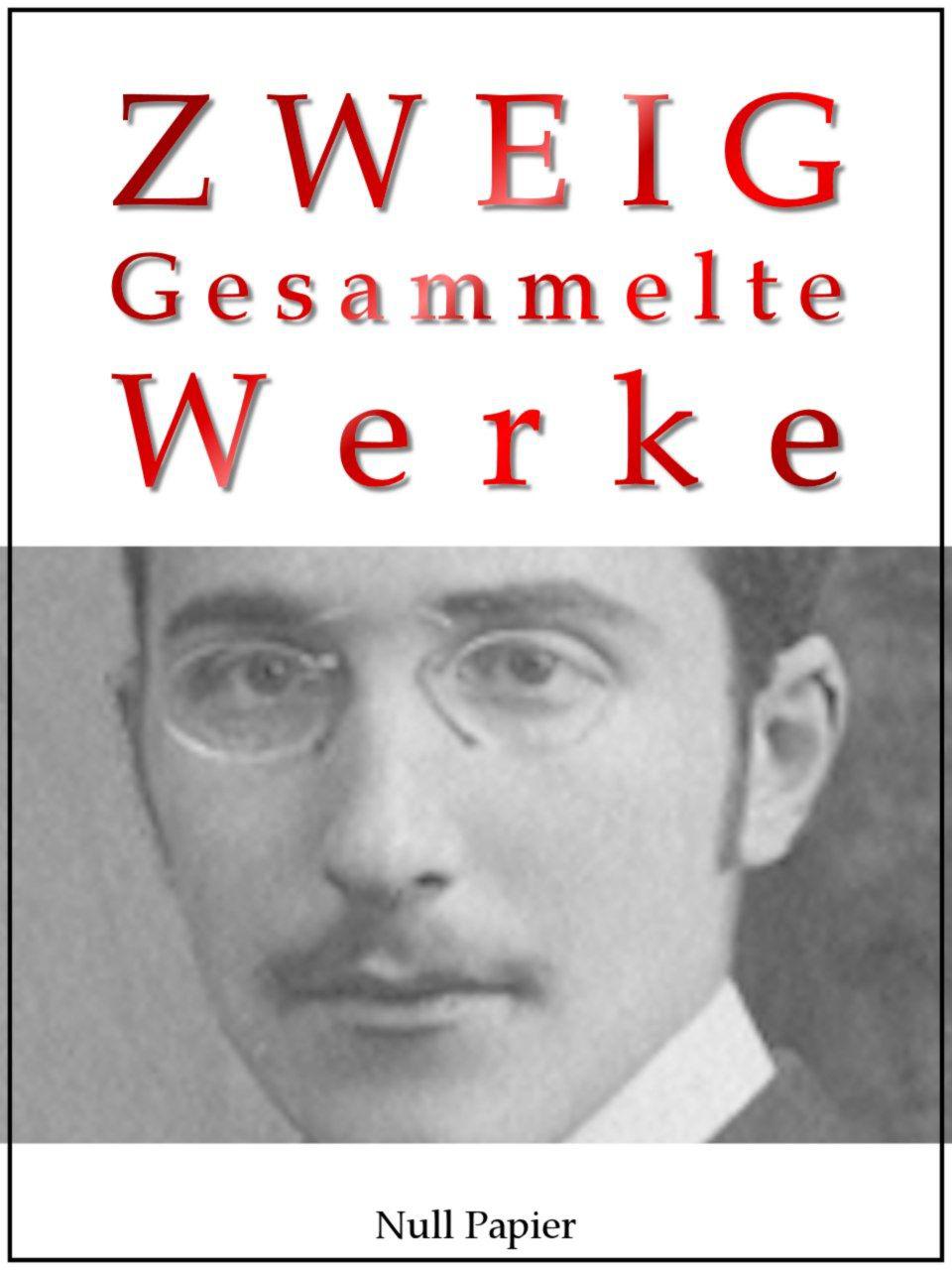![Stefan Zweig - Gesammelte Werke]()
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
ihren weiten bunten Röcken, die burgenländischen Bäuerinnen mit ihren gestickten Miedern und Hauben, genau denselben, mit denen sie im Dorf zum Kirchgang gingen, da waren die Marktweiber mit ihren grellen Schürzen und Kopftüchern, da waren die Bosniaken mit ihren kurzen Hosen und rotem Fes, die als Hausierer Tschibuks und Dolche verkauften, die Alpenländler mit ihren nackten Knien und dem Federhut, die galizischen Juden mit ihren Ringellocken und langen Kaftanen, die Ruthenen mit ihren Schafspelzen, die Weinbauern mit ihren blauen Schürzen, und inmitten all dessen als Symbol der Einheit die bunten Uniformen des Militärs und die Soutanen des katholischen Klerus. All das ging in seiner heimischen Tracht in Wien herum, genau so wie in der Heimat; keiner empfand es als ungehörig, denn sie fühlten sich hier zu Hause, es war ihre Hauptstadt, sie waren darin nicht fremd, und man betrachtete sie nicht als Fremde. Der erbeingesessene Wiener spottete gutmütig über sie, in den Couplets der Volkssänger war immer eine Strophe über den Böhmen, den Ungarn und den Juden, aber es war ein gutmütiger Spott zwischen Brüdern. Man haßte sich nicht, das gehörte nicht zur Wiener Mentalität.
Und es wäre auch sinnlos gewesen; jeder Wiener hatte einen Ungarn, einen Polen, einen Tschechen, einen Juden zum Großvater oder Schwager; die Offiziere, die Beamten hatten jeder ein paar Jahre in den Garnisonen der Provinz verbracht, sie hatten dort die Sprache erlernt, dort geheiratet; so waren aus den ältesten Wiener Familien immer wieder Kinder in Polen oder Böhmen oder im Trentino geboren worden; in jedem Hause waren tschechische oder ungarische Dienstmädchen und Köchinnen. So verstand jeder von uns von der Kindheit her ein paar Scherzworte der fremden Sprache, kannte die slawischen, die ungarischen Volkslieder, die die Mädchen in der Küche sangen, und der wienerische Dialekt war durchfärbt von Vokabeln, die sich allmählich dem Deutschen angeschliffen hatten. Unser Deutsch wurde dadurch nicht so hart, nicht so akzentuiert, nicht so eckig und präzis wie das der Norddeutschen, es war weicher, nachlässiger, musikalischer, und so wurde es uns auch leichter, fremde Sprachen zu lernen. Wir hatten keine Feindseligkeit zu überwinden, keinen Widerstand, es war in den besseren Kreisen üblich, Französisch, Italienisch sich auszudrücken, und auch von diesen Sprachen nahm man die Musik in die unsere hinein. Wir alle in Wien waren genährt von den Eigenarten der nachbarlichen Völker – genährt, ich meine es auch im wörtlichsten, im materiellen Sinne, denn auch die berühmte Wiener Küche war ein Mixtum compositum. Sie hatte aus Böhmen die berühmten Mehlspeisen, aus Ungarn das Gulasch und die anderen Zaubereien aus Paprika mitgebracht, Gerichte aus Italien, aus dem Salzburgischen und vom Süddeutschen her; all das mengte sich und ging durcheinander, bis es eben das Neue war, das österreichische, das Wienerische.
Alles wurde durch dieses ständige Miteinanderleben harmonischer, weicher, abgeschliffener, inoffensiver, und diese Konzilianz, die ein Geheimnis des wienerischen Wesens war, findet man auch in unserer Literatur. In Grillparzer, unserem größten Dramatiker, ist viel von der gestaltenden Kraft Schillers, aber das Pathetische fehlt glücklicherweise darin. Der Wiener ist zu selbstbeobachtend, um jemals pathetisch zu sein. In Adalbert Stifter ist das Kontemplative Goethes gewissermaßen ins Österreichische übersetzt, linder, weicher, harmonischer, malerischer. Und Hofmannsthal, ein Viertel Oberösterreicher, ein Viertel Wiener, ein Viertel Jude, ein Viertel Italiener, zeigt geradezu symbolisch, welche neuen Werte, welche Feinheiten und glücklichen Überraschungen sich durch solche Mischungen ergeben können. In seiner Sprache ist sowohl in Vers als auch in Prosa vielleicht die höchste Musikalität, die die deutsche Sprache erreicht hat, eine Harmonisation des deutschen Genius mit dem lateinischen, wie sie nur in Österreich, in diesem Lande zwischen den beiden, gelingen konnte. Aber dies ist ja immer das wahre Geheimnis Wiens gewesen: annehmen, aufnehmen, durch geistige Konzilianz verbinden und das Dissonierende lösen in Harmonie.
Deshalb und nicht durch einen bloßen Zufall ist Wien die klassische Stadt der Musik geworden. So wie Florenz die Gnade und den Ruhm hat, da die Malerei ihren Höhepunkt erreicht, in seinen Mauern alle die schöpferischen Gestalten im Raum eines Jahrhunderts zu versammeln, Giotto
Weitere Kostenlose Bücher