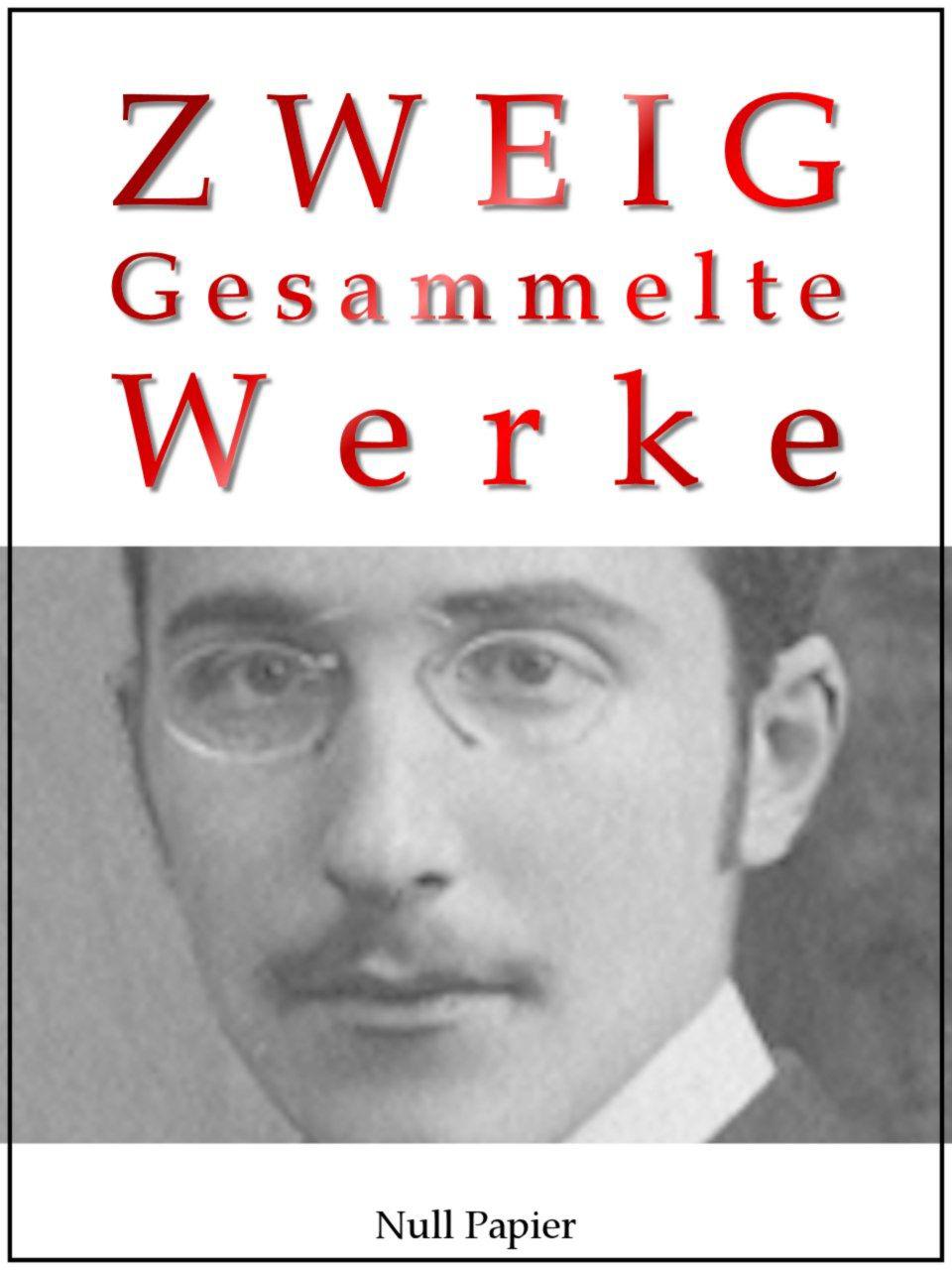![Stefan Zweig - Gesammelte Werke]()
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
Lobkowitzscher Esel! Der Fürst erfährt es, duldet es und trägt es ihm nicht nach. Als Beethoven Wien verlassen will, tun sich die Aristokraten zusammen, um ihm eine für die damalige Zeit enorme Lebensrente zu sichern ohne jede andere Verpflichtung, als in Wien zu bleiben und frei seinem Schaffen nachzugehen. Sie alle, sonst mittlere Leute, wissen, was große Musik ist und wie kostbar, wie verehrungswürdig ein großes Genie. Sie fördern die Musik nicht nur aus Snobismus, sondern, weil sie in Musik leben, fördern sie die Musik und geben ihr einen Rang über dem eigenen Rang.
Derselben Kennerschaft, derselben Leidenschaft begegnet im 18., im 19. Jahrhundert der Musiker im Wiener Bürgertum. Fast in jedem Hause wird einmal in der Woche Kammermusik abgehalten, jeder Gebildete spielt irgendein Instrument, jedes Mädchen aus gutem Hause kann ein Lied vom Blatt singen und wirkt mit in den Chören und Kapellen. Wenn der Wiener Bürger die Zeitung öffnet, ist sein erster Blick nicht, was in der Welt der Politik vorgeht; er schlägt das Repertoire der Oper und des Burgtheaters nach, welcher Sänger singt, welcher Kapellmeister dirigiert, welcher Schauspieler spielt. Ein neues Werk wird zum Ereignis, eine Premiere, das Engagement eines neuen Kapellmeisters, eines neuen Sängers an der Oper ruft endlose Diskussionen hervor, und der Kulissentratsch über die Hoftheater erfüllt die ganze Stadt. Denn das Theater, insbesondere das Burgtheater, bedeutet den Wienern mehr als eben bloß ein Theater; es ist der Mikrokosmos, der den Makrokosmos spiegelt, ein sublimiertes konzentriertes Wien innerhalb Wiens, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Das Hoftheater zeigt der Gesellschaft vorbildlich, wie man sich in Gesellschaft benimmt, wie man Konversation macht in einem Salon, wie man sich anzieht, wie man spricht und sich gebärdet, wie man eine Tasse Tee nimmt und wie man eintritt und wie man sich verabschiedet. Es ist eine Art Cortigiano, ein Sittenspiegel des guten Benehmens, denn im Burgtheater darf so wenig ein unpassendes Wort gesagt werden wie in der Comédie Française, in der Oper kein falscher Ton gesungen werden: es wäre eine nationale Schande. Wie in einen Salon geht man nach italienischem Vorbild in die Oper, in das Burgtheater. Man trifft sich, man kennt sich, man begrüßt sich, man ist bei sich, man ist zu Hause. Im Burgtheater und in der Oper fließen alle Stände zusammen, Aristokratie und Bürgertum und die neue Jugend. Sie sind das große Gemeinsame, und alles, was dort geschieht, gehört der ganzen Stadt an. Als das alte Gebäude des Burgtheaters abgerissen wird, dasselbe in dem die ›Hochzeit des Figaro‹ zum erstenmal erklang, ist ein Trauertag in ganz Wien. Um sechs Uhr morgens stellen sich die Enthusiasten vor den Türen an und stehen dreizehn Stunden bis abends, ohne zu essen, ohne zu trinken, nur um der letzten Vorstellung in diesem Hause beiwohnen zu können. Von der Bühne brechen sie sich Holzsplitter heraus und bewahren sie genau so wie einstmals Fromme die Splitter vom heiligen Kreuz. Nicht nur der Dirigent, der große Schauspieler, der gute Sänger wird wie ein Gott vergöttert, diese Leidenschaft geht über auf den unbeseelten Raum. Ich war selbst beim letzten Konzert in dem alten Bösendorfer-Saal. Es war gar kein besonders schöner Saal, der da abgerissen wurde, eine frühere Reitschule des Fürsten Liechtenstein, einfach in Holz getäfelt. Aber er hatte die Resonanz einer alten Geige, und Chopin und Brahms hatten noch darin gespielt und Rubinstein und das Rosé-Quartett. Viele Meisterwerke waren dort zum erstenmal für die Welt erklungen, es war der Ort gewesen, wo alle Liebhaber von Kammermusik durch Jahre und Jahre Woche für Woche einander begegnet waren, eine einzige Familie. Und da standen wir nun nach dem letzten Beethoven-Quartett in dem alten Raum und wollten nicht, daß es zu Ende war. Man tobte, man schrie, einige weinten. Im Saal wurden die Lichter gelöscht. Es half nichts. Alle blieben im Dunkel, als wollten sie es erzwingen, daß auch dieser Saal bliebe, der alte Saal. So fanatisch empfand man in Wien nicht nur für die Kunst, die Musik, sondern sogar für die bloßen Gebäude, die mit ihr verbunden waren.
Übertreibung, werden Sie sagen, lächerliche Überschätzung! Und so haben wir selbst manchmal diesen geradezu irrwitzigen Enthusiasmus der Wiener für Musik und Theater empfunden. Ja, er war manchmal lächerlich, ich weiß es, wie zum Beispiel damals, als die guten
Weitere Kostenlose Bücher