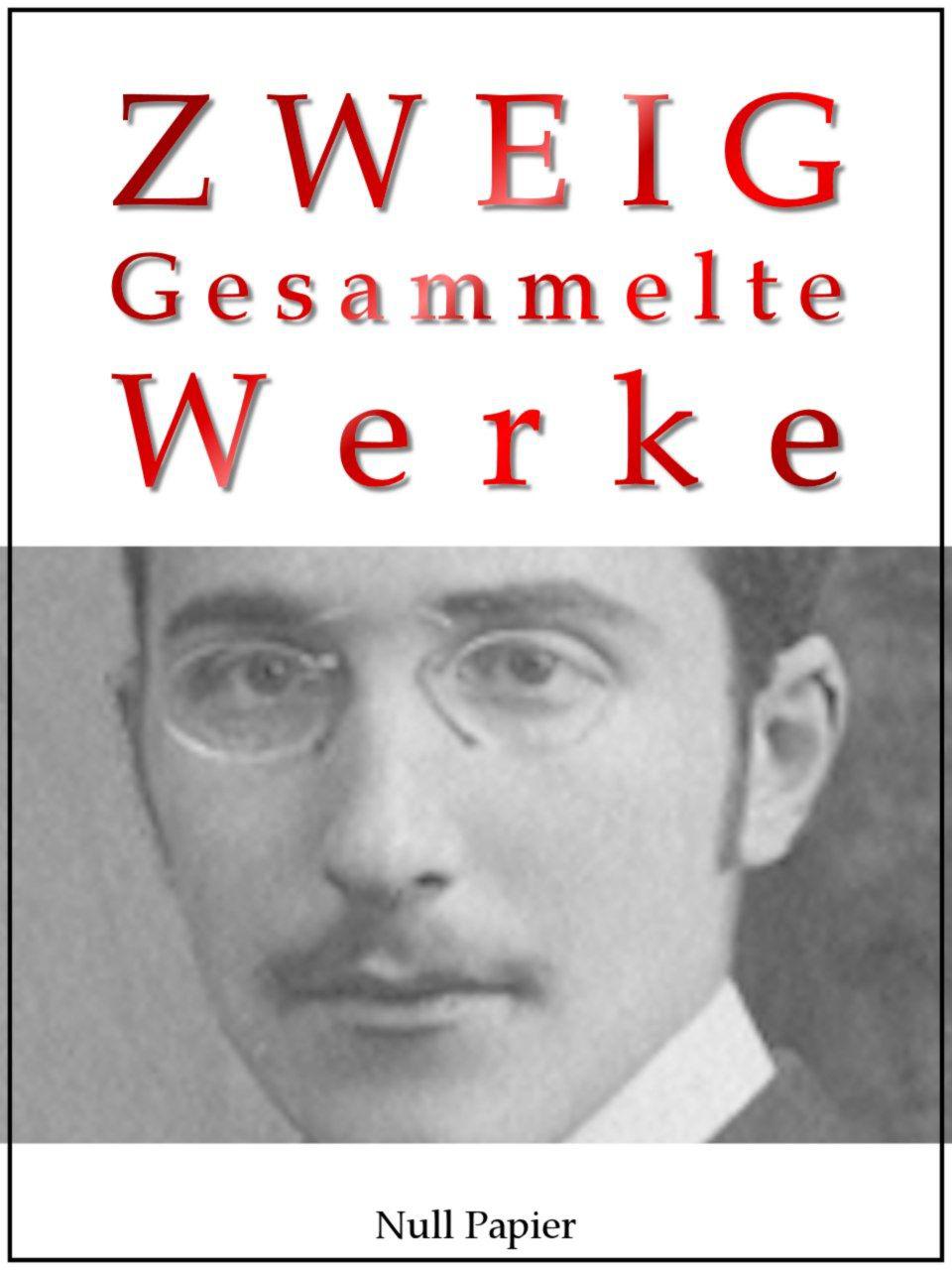![Stefan Zweig - Gesammelte Werke]()
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
für einen Tag – und man meint auf Zauberflügeln plötzlich in die Schweiz getragen zu sein; da liegt, ein paar Dutzend Meter entfernt vom Strande, ein See, die Lagoa Rodrigo de Freitas, rings von Bergen umschlossen. An seinem flachen Rande hat sich mit unheimlicher Geschwindigkeit eine ganz neue Villenstadt angeschmiegt, aber über ihm halten die Berge Wacht, und des Nachts spiegeln sich ihre dunklen Konturen magisch in seinem schwarzen Metall. Aber nicht rasten! Nur einen Blick auf diesen Bergsee inmitten einer Metropole, auf den romantische Negerhütten unbekümmert niederblicken; noch ein anderer langer Strand, der von Ipanema und noch ein zweiter, der von Leblon, ist zu umfahren, wo noch die Häuser und die Palmen des Boulevards jung sind. Dann erst nähert die Avenue sich der offenen Natur, und es beginnt die Avenida Niemeyer, wie die Corniche der Riviera in und durch den Fels gesprengt, hart an dem immer felsiger, immer abrupter werdenden Strand sieht sie hinab auf das Meer, das hier unruhiger und gefährlicher sich gebärdet. Aber zur Rechten beruhigen schützend die Hügel, mit grünem Gestrüpp, mit Palmen und Bananen niedersteigend – es ist eine Fahrt voller Abwechslungen, ehe man bei Joê einen Hügel erreicht, der Rast und Überblick gewährt. Aufgetan die Bucht mit ihren Inseln und Felsen, aufgerollt das Panorama der fernen Berge, verschwunden hinter dieser farbigen Kulisse die Stadt – man ist im Freien, man ist am Ende! Aber wie lange noch? Ein Jahr? Ein Jahrzehnt? Denn schon werden am nächsten Strande, der Praia da Tijuca, die Grundstücke ausgemessen; wo Sand weiß und weich einem jetzt den Schuh füllt, wird bald eine neue Häuserfront sich gegen das Meer stellen – wer kann sagen, wo Rio enden wird, wo es wirklich innehält.
Und wieder eine Kehre und wieder eine andere Welt. Der Wagen klettert in steilen Kehren den Berg hinauf, für eine Viertelstunde ist man im Urwald; kaum ein Haus, bestenfalls ein paar Hütten, halb von Palmen verdeckt, in denen die Neger hausen. Schon beginnt man zu vergessen, daß man doch nur einen einstündigen Ausflug innerhalb der Stadtgrenze unternommen, und man hat das Gefühl, in dieser Zeit sich um Meilen und Meilen entfernt zu haben. Aber plötzlich an einer Kehre blickt man hinab, und da liegt sie wieder, die Stadt! Ganz anders liegt sie da, weil von einer anderen Seite gesehen, man erkennt sie und erkennt sie doch nicht. Und welchen Weg immer man nun nimmt, höher noch aufsteigend zu der Vista Chinesa, der Mesa do Imperador oder rückkehrend durch Tijuca, diesen alten aristokratischen Villenort, überall verschieben sich die Perspektiven; ein fotografischer Apparat verbrauchte zehn Dutzend Filmstreifen, um nur die überraschendsten dieser Aspekte festzuhalten. Und dann ist man wieder in der Stadt, man weiß nicht aus welcher Richtung und in welche Richtung – nach Monaten findet man sich noch nicht zurecht – und wieder auf neuen Boulevards, etwa dem palmenbestandenen der Mangue oder vorbei am Jardim Botânico oder auf der parkhaften Praça da República. In ein oder zwei Stunden hat man nicht nur eine Stadt sondern eine Welt umschwungen und steht, noch sanft taumelig, inmitten des farbigen Tumults der Menschen und Geschäfte: die eine dieser südländischen Straßen erinnert an die Cannebière von Marseille, die andere, steil die Hügel hinan, an Neapel, die tausend Kaffeehäuser mit heiter schwatzenden Männern an Barcelona oder Rom, die Lichtspielhäuser mit ihren Reklamen und die Hochhäuser an New York. Man ist zugleich überall und weiß doch an jenem einzigartigen Zusammenklang: man ist in Rio.
Die kleinen Straßen
D iese großen Boulevards sind das Neue, das Grandiose an Rio; weniges der Welt kann ihnen an Großartigkeit der Anlage und an landschaftlicher Schönheit verglichen werden. Aber sie sind Fahrstraßen, Paradestraßen, moderne, internationale Straßen, und ich liebe noch mehr als ihre blendende Pracht die kleinen Straßen, die namenlosen, die ungeachteten, die einen wandern lassen, ohne daß man weiß wohin, die einen ununterbrochen mit kleinem, natürlichem, südlichem Charme entzücken und um so romantischer wirken, je ärmer, je urtümlicher, je anspruchsloser sie sind. Auch die ärmsten – und gerade diese – sind voll von Farbe und Leben und wechselndem Bild. Man kann sich nicht satt sehen an ihnen. Nichts in ihnen ist hergerichtet, appretiert für den Fremden, nichts fotografierbar, und ihr Zauber ist nicht die Architektur, die
Weitere Kostenlose Bücher