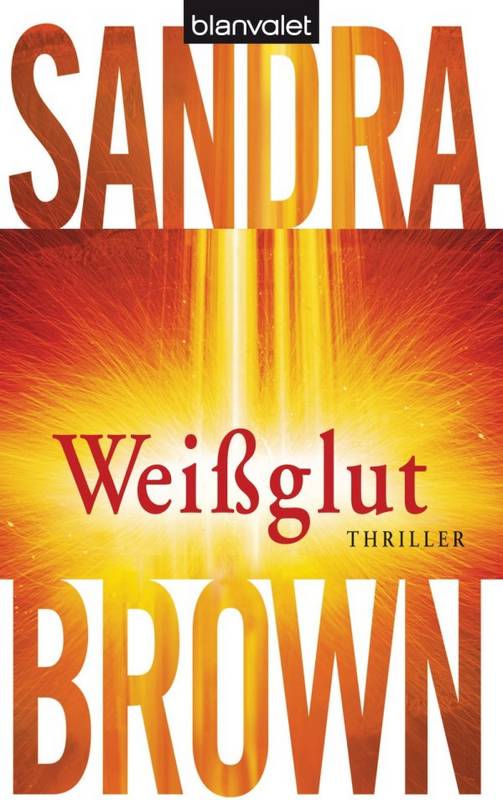![Weißglut]()
Weißglut
gezogen. Einer der anderen Männer ist zum Schalter gerannt und hat alles angehalten, aber bis dahin …« Der Vorarbeiter schluckte schwer. »Wir haben gar nicht erst auf den Krankenwagen gewartet. Wir haben ihn einfach hochgehoben und hergefahren.«
Er deutete auf drei weitere Männer, die mit gesenkten Köpfen auf den Stühlen im Wartebereich saßen und genauso blutig und zittrig wirkten wie ihr Vorarbeiter. »Billys Arm hing nur noch an einem dünnen Strang. Moe musste ihn festhalten, sonst wäre er einfach abgefallen.«
»Ziemlich schlimm« war eindeutig untertrieben. Das war eine Katastrophe. »War er bei Bewusstsein?«, fragte Beck.
»Als wir ihn rauszogen, schrie er wie am Spieß. Das Geschrei werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Er klang nicht mehr menschlich. Dann ist er wohl in einen Schock gefallen. Jedenfalls hörte er plötzlich auf zu schreien.«
»Haben Sie schon mit einem Arzt gesprochen?«
»Nein, Sir. Sie haben Billy da hinten reingeschoben, und seitdem haben wir niemanden mehr zu sehen bekommen außer der Schwester an der Theke dahinten.«
»Er hat eine Familie, nicht wahr?«
»Ich habe Alicia angerufen. Sie ist noch nicht hier.«
Beck legte dem Mann die Hand auf die Schulter. »Sie haben alles für Billy getan, was in Ihrer Macht stand. Von jetzt an übernehme ich.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir gern noch dableiben, Mr. Merchant. Wir haben schon ein paar Männer angerufen, die bis zum Schichtende für uns einspringen. Wir würden gern wissen, ob Billy durchkommt. Er hat eine Menge Blut verloren.«
Beck wollte sich nicht einmal vorstellen, dass Billy nicht durchkäme. »Er wäre Ihnen bestimmt dankbar.«
Fred wollte sich schon abwenden, als ihm noch eine Frage in den Sinn kam: »Wie geht es eigentlich Mr. Hoyle?«
»Er ist vorerst außer Gefahr. Ich glaube, er wird sich wieder erholen.«
Beck ließ die vier Gießereiarbeiter allein und wählte Chris’ Handynummer. Es läutete sechsmal, dann schaltete sich die Mailbox ein. Beck hinterließ eine Nachricht. »Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass wir unsere Handys eingeschaltet lassen. Ruf mich an. Huff geht es gut, soweit ich weiß, aber wir haben einen weiteren Notfall.«
Die Schwester an ihrer Theke weigerte sich, ihm Auskunft zu geben. Verärgert über ihre absichtlich vagen Antworten, fuhr Beck sie an: »Können Sie mir wenigstens sagen, ob er noch lebt?«
»Sie sind kein Angehöriger, nicht wahr?«
»Nein, aber ich bin derjenige, der die verfluchte Krankenhausrechnung zahlt. Was mich wohl dazu berechtigt zu erfahren, ob er durchkommen wird oder nicht.«
»Bitte nicht in diesem Tonfall, Sir.«
»Also, wenn Ihnen was an Ihrem Job liegt, Madam, dann sollten Sie mit der Sprache rausrücken. Und zwar schnell.«
Sie richtete sich auf. Ihre Lippen schienen sich beim Sprechen kaum zu bewegen. »Ich glaube, der Patient wird in Kürze per Hubschrauber zu einer Unfallklinik in New Orleans geflogen. Mehr weiß ich auch nicht.«
Beck hörte eine Bewegung hinter sich, drehte sich um und sah eine Frau hereingeeilt kommen, gefolgt von fünf Kindern. Alle waren barfuß, im Schlafanzug und bleich vor Angst. Die Kleinste hatte einen zerlumpten, einäugigen Teddy unter den Arm geklemmt. Die Frau war kurz vor einem hysterischen Ausbruch.
»Fred!«, schrie sie, als er aufstand und auf sie zukam. Als sie das Blut ihres Mannes auf den Kleidern der Übrigen sah, brach sie mit einem Aufschrei in die Knie. »Sagt mir, dass er nicht tot ist. Bitte! Sagt mir, dass er noch am Leben ist.«
Die Kollegen ihres Mannes eilten herbei, um ihr beizustehen. Sie hoben sie vom Boden auf und setzten sie auf einen Stuhl. »Er ist nicht tot«, erklärte ihr Fred. »Aber er ist übel verletzt, Alicia.«
Die Kinder waren verblüffend still, wahrscheinlich hatte ihnen der Aufschrei ihrer Mutter die Sprache verschlagen.
»Ich will zu ihm«, befahl sie hektisch. »Kann ich zu ihm?«
»Noch nicht. Sie verarzten ihn gerade und lassen niemanden rein.«
Fred Decluette versuchte, sie zu beruhigen und ihr gleichzeitig zu erklären, wie es zu dem Unfall gekommen war. Er kam mit seiner Stimme kaum gegen ihr Schluchzen an. Beck wandte sich noch einmal an die Krankenschwester, die die Szene leidenschaftslos verfolgte.
»Können Sie ihr irgendwas geben, um sie zu beruhigen?« , fragte er.
»Nur wenn es ein Arzt verschreibt.«
Mit hörbar angespannter Stimme sagte er: »Wie wär’s, wenn Sie einen holen würden?« Mit einem äußerst indignierten
Weitere Kostenlose Bücher