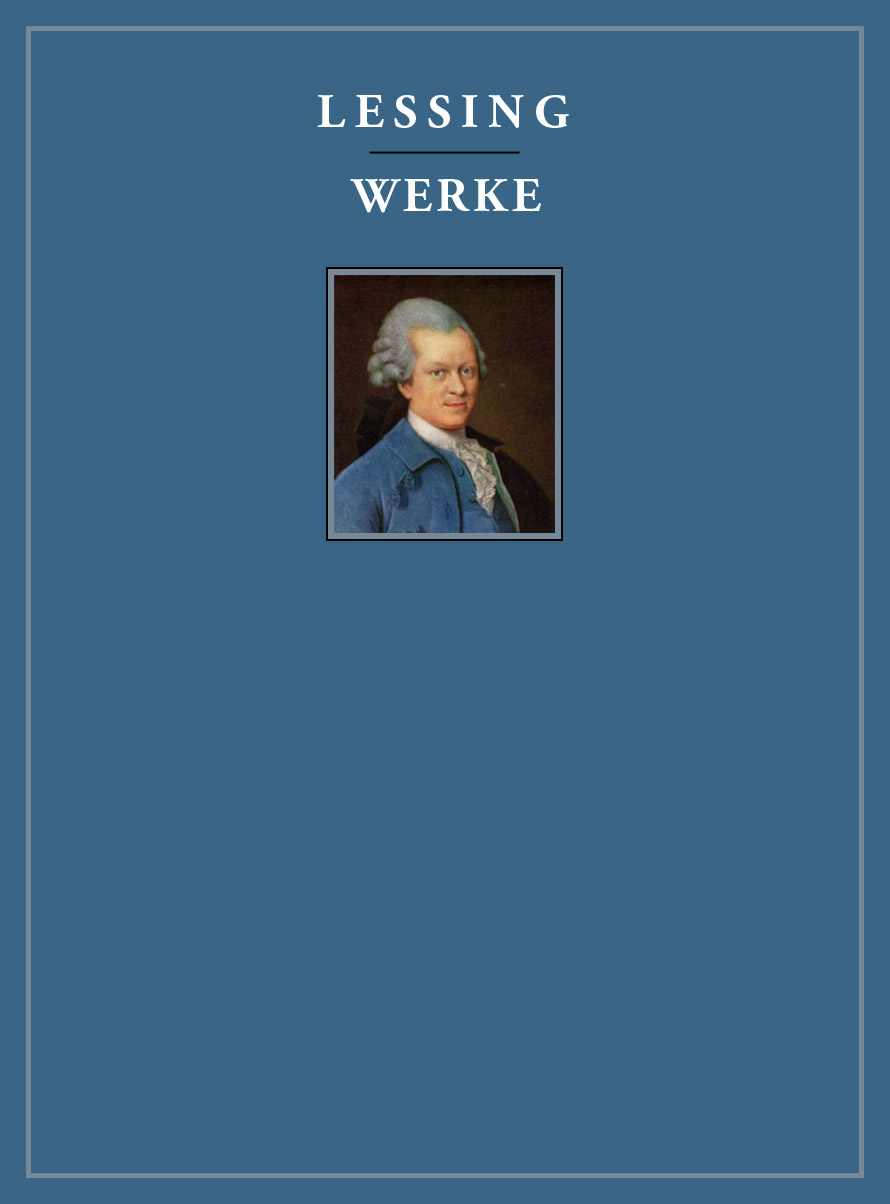![Werke]()
Werke
Furchtsamkeit, die sich nicht getrauet, ihn in Gegenwart des Severus zu retten, vor dessen Hasse und Rache er in Sorgen stehet. Man fasset also wohl einigen Unwillen gegen ihn, und mißbilliget sein Verfahren; doch überwiegt dieser Unwille nicht das Mitleid, welches wir für den Polyeukt empfinden, und verhindert auch nicht, daß ihn seine wunderbare Bekehrung, zum Schlusse des Stücks, nicht völlig wieder mit den Zuhörern aussöhnen sollte.« Tragische Stümper, denke ich, hat es wohl zu allen Zeiten, und selbst in Athen gegeben. Warum sollte es also dem Aristoteles an einem Stücke, von ähnlicher Einrichtung, gefehlt haben, um daraus eben so erleuchtet zu werden, als Corneille? Possen! Die furchtsamen, schwanken, unentschlossenen Charaktere, wie Felix, sind in dergleichen Stücken ein Fehler mehr, und machen sie noch oben darein ihrer Seits kalt und ekel, ohne sie auf der andern Seite im geringsten weniger gräßlich zu machen. Denn, wie gesagt, das Gräßliche liegt nicht in dem Unwillen oder Abscheu, den sie erwecken: sondern in dem Unglücke selbst, das jene unverschuldet trifft; das sie einmal so unverschuldet trifft als das andere, ihre Verfolger mögen böse oder schwach sein; mögen mit oder ohne Vorsatz ihnen so hart fallen. Der Gedanke ist an und für sich selbst gräßlich, daß es Menschen geben kann, die ohne alle ihr Verschulden unglücklich sind. Die Heiden hätten diesen gräßlichen Gedanken so weit von sich zu entfernen gesucht, als möglich: und wir wollten ihn nähren? wir wollten uns an Schauspielen vergnügen, die ihn bestätigen? wir? die Religion und Vernunft überzeuget haben sollte, daß er eben so unrichtig als gotteslästerlich ist? – Das nämliche würde sicherlich auch gegen die dritte Manier gelten; wenn sie Corneille nicht selbst näher anzugeben, vergessen hätte.
5. Auch gegen das, was Aristoteles von der Unschicklichkeit eines ganz Lasterhaften zum tragischen Helden sagt, als dessen Unglück weder Mitleid noch Furcht erregen könne, bringt Corneille seine Läuterungen bei. Mitleid zwar, gesteht er zu, könne er nicht erregen; aber Furcht allerdings. Denn ob sich schon keiner von den Zuschauern der Laster desselben fähig glaube, und folglich auch desselben ganzes Unglück nicht zu befürchten habe: so könne doch ein jeder irgend eine jenen Lastern ähnliche Unvollkommenheit bei sich hegen, und durch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber doch noch immer unglücklichen Folgen derselben, gegen sie auf seiner Hut zu sein lernen. Doch dieses gründet sich auf den falschen Begriff, welchen Corneille von der Furcht und von der Reinigung der in der Tragödie zu erweckenden Leidenschaften hatte, und widerspricht sich selbst. Denn ich habe schon gezeigt, daß die Erregung des Mitleids von der Erregung der Furcht unzertrennlich ist, und daß der Bösewicht, wenn es möglich wäre, daß er unsere Furcht erregen könne, auch notwendig unser Mitleid erregen müßte. Da er aber dieses, wie Corneille selbst zugesteht, nicht kann, so kann er auch jenes nicht, und bleibt gänzlich ungeschickt, die Absicht der Tragödie erreichen zu helfen. Ja Aristoteles hält ihn hierzu noch für ungeschickter, als den ganz tugendhaften Mann; denn er will ausdrücklich, Falls man den Held aus der mittlern Gattung nicht haben könne, daß man ihn eher besser als schlimmer wählen solle. Die Ursache ist klar: ein Mensch kann sehr gut sein, und doch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in ein unabsehliches Unglück stürzet, das uns mit Mitleid und Wehmut erfüllet, ohne im geringsten gräßlich zu sein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ist. – Was Du Bos (133) von dem Gebrauche der lasterhaften Personen in der Tragödie sagt, ist das nicht, was Corneille will. Du Bos will sie nur zu den Nebenrollen erlauben; bloß zu Werkzeugen, die Hauptpersonen weniger schuldig zu machen; bloß zur Abstechung. Corneille aber will das vornehmste Interesse auf sie beruhen lassen, so wie in der Rodogune: und das ist es eigentlich, was mit der Absicht der Tragödie streitet, und nicht jenes. Du Bos merket dabei auch sehr richtig an, daß das Unglück dieser subalternen Bösewichter keinen Eindruck auf uns mache. Kaum, sagt er, daß man den Tod des Narciß im Britannicus bemerkt. Aber also sollte sich der Dichter, auch schon deswegen, ihrer so viel als möglich enthalten. Denn wenn ihr Unglück die Absicht der Tragödie nicht unmittelbar befördert, wenn sie
Weitere Kostenlose Bücher