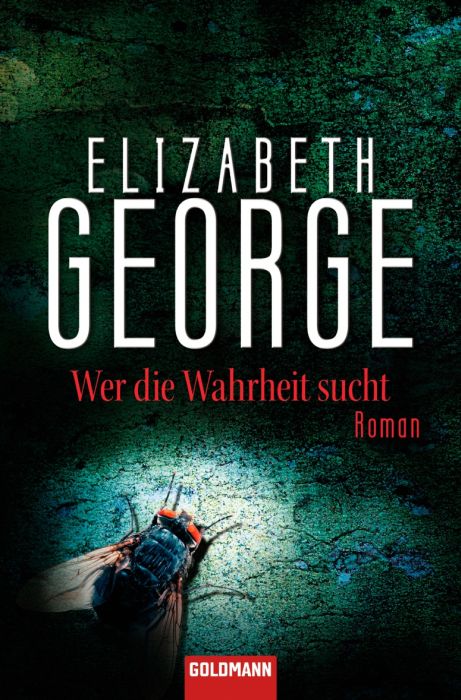![12 - Wer die Wahrheit sucht]()
12 - Wer die Wahrheit sucht
Ruth konnte also mit dem Bild tun, was sie wollte. Solange St. James Schweigen bewahrte.
Le Gallez wusste zwar von dem Gemälde, aber was wusste er schon? Einzig, dass China River ein Kunstwerk aus der Sammlung Guy Brouards hatte stehlen wollen. Mehr nicht. Was es für ein Kunstwerk war, wer es geschaffen hatte, woher es gekommen war, wie der Raubüberfall durchgeführt worden war... das alles wusste nur St. James. Und er konnte über dieses Wissen verfügen, wie er wollte.
Ruth sagte: »Es wurde immer vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben. Es symbolisierte wahrscheinlich den Übertritt von der Generation der Jungen in die der Erwachsenen. Möchtest du es haben, mein Junge?«
Adrian schüttelte den Kopf. »Vielleicht später einmal«, sagte er. »Aber jetzt, nein. Dad hatte es für dich gewollt.«
Mit einer zärtlichen Geste berührte Ruth die Leinwand an jener Stelle, wo das Gewand der Heiligen Barbara in fließender Bewegung herabfiel. Hinter der Heiligen waren die Steinmetze am Werk und schichteten ihre gewaltigen Granitblöcke für die Ewigkeit auf. Ruth blickte lächelnd auf das heitere Antlitz der Heiligen und murmelte: »Merci, mon frère. Merci. Tu as tenu cent fois la promesse que tu avais fait à Maman.« Dann riss sie sich aus ihren Gedanken und sah St. James an. »Sie wollten sie noch einmal sehen. Warum?«
Die Antwort war einfach. »Weil sie schön ist«, sagte er, »und ich mich verabschieden wollte.«
Sie brachten ihn zur Treppe. Er versicherte, von hier würde er den Weg allein finden. Sie begleiteten ihn trotzdem einen Stock tiefer. Doch dort machten sie Halt. Ruth erklärte, sie wolle sich in ihrem Zimmer niederlegen. Ihre Kräfte ließen täglich ein wenig mehr nach.
Adrian sagte, er würde sie begleiten. »Nimm meinen Arm, Tante Ruth«, forderte er sie auf.
In einem unbequemen skandinavischen Sessel sitzend, erwartete Deborah den letzten Besuch ihres Neurologen. Nur diese Hürde musste sie noch nehmen, dann würde sie mit Simon nach England heimkehren können. Voll Zuversicht, dass der Arzt ihr seinen Segen geben würde, hatte sie sich bereits fertig angekleidet. Um keinen Zweifel an ihren Absichten aufkommen zu lassen, hatte sie sogar ihr Bett abgezogen.
Ihr Gehör wurde von Tag zu Tag besser. Ein Assistenzarzt hatte ihr die Fäden am Kinn gezogen. Die Blutergüsse verblassten langsam, die Schnitte und Schrammen in ihrem Gesicht verschwanden. Die seelischen Verletzungen würden langsamer verheilen. Sie hatte die Schmerzen bisher erfolgreich verdrängt, aber sie wusste, irgendwann würde sie sich ihnen stellen müssen.
Als die Tür geöffnet wurde, glaubte sie, es wäre der Arzt, und sprang auf, um ihm entgegenzugehen. Aber es war Cherokee River. Er sagte: »Ich wollte eigentlich gleich kommen, aber es - es war alles ein bisschen viel auf einmal. Und dann, als sich alles etwas beruhigte, wusste ich nicht, wie ich dir gegenübertreten soll. Was ich sagen soll. Und ich weiß es immer noch nicht. Aber ich musste kommen. Ich fliege in zwei Stunden.«
Sie bot ihm die Hand, aber er ergriff sie nicht. Sie ließ sie sinken und sagte: »Es tut mir so Leid.«
»Ich bringe sie nach Hause«, sagte er. »Mam wollte rüberkommen und mir helfen, aber ich hab ihr gesagt...« Er lachte ein wenig, aber es klang schmerzlich. Er fuhr sich mit der Hand durch das lockige Haar. »Sie würde Mam nicht hier haben wollen. Sie wollte sie nie in ihrer Nähe haben. Außerdem wäre es völlig sinnlos, dass sie herkommt. Den ganzen Flug, nur um gleich wieder zurückzufliegen. Aber sie wollte kommen. Sie hat sehr geweint. Sie hatten ewig nicht mehr miteinander geredet - ich weiß nicht, ein Jahr lang, vielleicht, oder zwei? China mochte es nicht... Ach, ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was China nicht mochte.«
Deborah drängte ihn, in dem niedrigen und unbequemen Sessel Platz zu nehmen. Aber er wehrte ab. »Nein, setz du dich.«
Sie sagte: »Ich setz mich aufs Bett« und hockte sich auf die Kante der unbezogenen Matratze. Cherokee setzte sich schließlich doch in den Sessel, auf seinen äußersten Rand, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Deborah wartete darauf, dass er etwas sagen würde. Sie selbst wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie konnte nur immer wieder ihren Schmerz über das Geschehene betonen.
Er sagte: »Ich versteh das alles nicht. Ich kann immer noch nicht glauben... Es gab überhaupt keinen Grund. Aber sie muss es von Anfang an geplant haben. Ich verstehe nur nicht,
Weitere Kostenlose Bücher