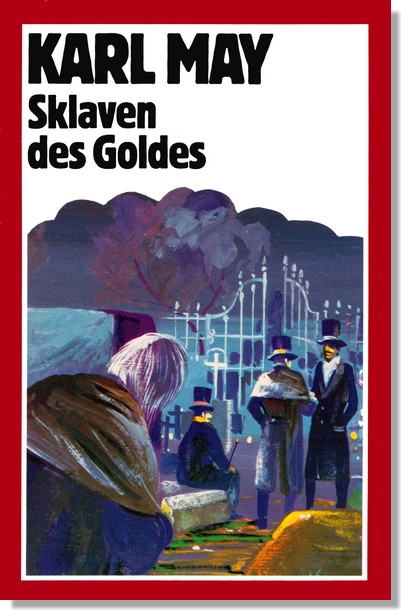![63 - Der verlorene Sohn 04 - Sklaven des Goldes]()
63 - Der verlorene Sohn 04 - Sklaven des Goldes
ich.“
„Was nützt sie dir also? Du kannst sie nicht gebrauchen.“
„Keine Sorge! Ist sie einmal bei mir, so gehorcht sie.“
„Das bezweifle ich!“
„Pah! Ein Zirkusdirektor hat ganz andere Mittel, sein Personal gefügig zu machen, als so ein armer Teufel von Theaterintendant. Natürlich liegt mir sehr daran, daß Werner seine Entlassung möglichst bald erfährt!“
„Er wird sie augenblicklich erfahren.“
„Du läßt ihn benachrichtigen?“
„Nein. Ich gehe sofort selbst zu ihm.“
„Du selbst?“
„Ja. Es ist sehr notwendig, mich selbst von der Gefährlichkeit der Krankheit seiner Frau zu überzeugen. Nur auf diese Weise kann ich erfahren, was ich am besten tue. Gehe jetzt zu mir nach Hause. Ich werde dir Bericht erstatten.“
„Danke! Selbst ist der Mann. Ich gehe auch zu Werner.“
„Was fällt dir ein!“
„Keine Sorge! Ich werde nicht unvorsichtig sein. Natürlich gehe ich nicht mit dir zu ihm. Ich werde das Terrain rekognoszieren, um zu erfahren, wie ich an ihn kommen kann. Gehe du also voran. Ich folge dir, um zu sehen, wo er wohnt.“
„Ganz, wie du willst. Er wohnt da, wo du mich eintreten siehst, vier Treppen hoch im Hinterhaus. Ich bin neugierig, ob du das Mädchen wegangelst.“
Er ging, und sein Bruder folgte ihm von weitem.
Gegenüber dem betreffenden Haus lag auf der anderen Seite der Straße ein kleiner Materialwarenladen von der Art, welche man gewöhnlich mit dem Namen Büdchen bezeichnet. Dieser Laden war mit einem Bier- und Schnapsausschank verbunden.
Hier trat, nachdem sein Bruder drüben im Eingang verschwunden war, der Kunstreiter ein. Er kaufte sich zum Schein einige Zigarren und bemerkte dabei eine Nebenstube, in welcher einige Tische und Stühle standen.
„Ist das etwa ein Gastzimmer?“ fragte er.
„Ja“, lautete die Antwort. „Ich habe zwar keine eigentliche Restauration, aber für diejenigen, welche ein Bier oder einen Schnaps trinken wollen, muß doch ein Tisch und ein Stuhl dastehen.“
„So geben Sie mir auch ein Glas Bier!“
Er setzte sich in die Nebenstube, und zwar so, daß er die Tür des gegenüberliegenden Hauses im Auge hatte.
Sein Bruder stieg indessen da drüben die vier Treppen empor, klopfte an und öffnete die Tür. Der Blick, den er in das Zimmer und auf die Bewohner desselben warf, sagte ihm, daß es soeben eine Szene gegeben habe. Emilie stand weinend vor ihrem Vater, welcher sich auch in tiefer Rührung zu befinden schien und beim Anblick seines Vorgesetzten einen Ruf des Schreckens ausstieß:
„Mein Gott! Der Herr Intendant!“
„Ja, ich bin es“, sagte dieser, indem er hereinkam und die Tür hinter sich zuzog.
Werner beeilte sich, einen Stuhl anzubieten. Der Intendant aber wehrte ab und fragte in strengem Ton:
„Ihre Tochter hat Ihnen wohl bereits erzählt, was vorhin geschehen ist?“
„Ja.“
„Nun, was sagen Sie dazu?“
„Ich bedaure recht sehr, daß Emilie einen so großen Widerwillen gegen diese Rolle hat!“
„Und ich bedauere noch mehr, daß Sie Ihre Kinder nicht besser erzogen haben!“
„Herr Intendant!“
„Ja, ja! Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn ein Vater sich nicht Gehorsam zu verschaffen vermag. Sie bringen mich da in eine große Verlegenheit. Woher soll ich denn nun eine Sultanin nehmen?“
Es war ein schlimmes Zeichen für Werner, daß er sich mit ‚Sie‘ angeredet hörte. Dennoch nahm er sich den Mut zu der Bemerkung:
„Vielleicht gibt es Leute, welche Emilie nicht tadeln würden. Und ich hoffe, daß die Rolle doch noch zu besetzen ist.“
„Aber wie! Es fehlt ja an einer geeigneten Persönlichkeit. Aber – hm! – was haben sie hier für eine Luft! Das ist ein fürchterlicher, ein penetranter Geruch! Wer ist die verhüllte Person dort?“
Erst jetzt dachte Werner an die Gefahr, in welcher er schwebte. Er antwortete verlegen:
„Es ist meine Frau, sie leidet an Ohrenzwang.“
„Sie lügen! Ihre Frau hat den Krebs!“
Werner erschrak so, daß er zu antworten vergaß.
„Nun, habe ich recht?“ fragte der Intendant.
„Ja“, stöhnte der Theaterdiener.
„Sie geben also zu, mich belogen zu haben! Warum haben sie mich über diese Krankheit nicht benachrichtigt?“
„Ich glaubte nicht, Sie belästigen zu dürfen.“
„Belästigen? Von einer Belästigung kann nicht die Rede sein. Man kann nur von einer Verpflichtung sprechen. Es war Ihre Pflicht, mir zu melden, daß sich der Krebs in Ihrer Familie befindet. Wie alt ist die Krankheit?“
„Einige Jahre.“
„Und
Weitere Kostenlose Bücher