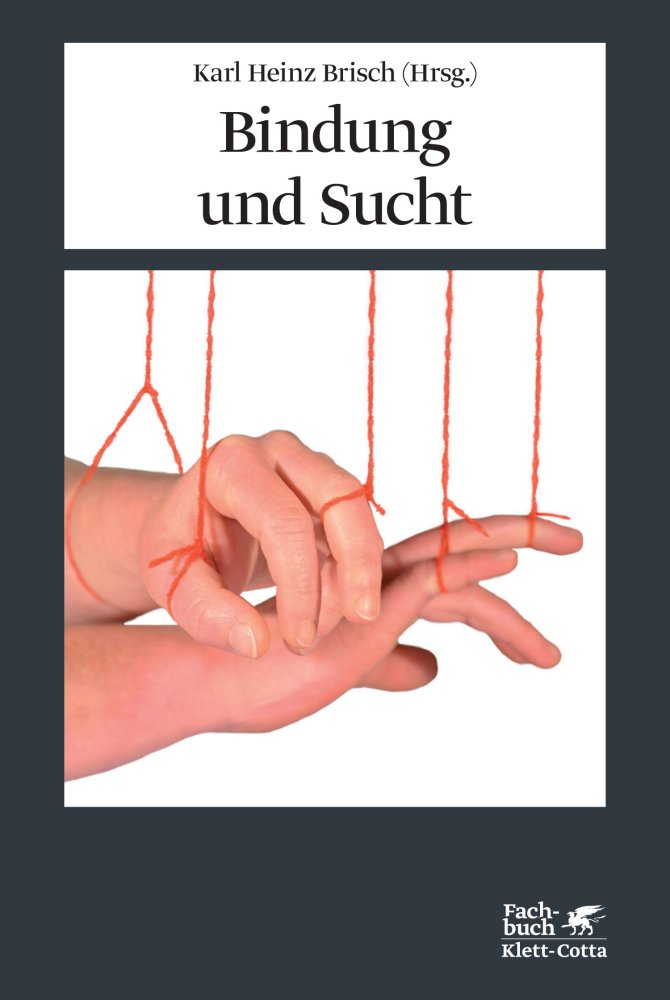![Bindung und Sucht]()
Bindung und Sucht
ist ein evolutionäres Geburtsrecht aller Säugetiergehirne. Deshalb ist die Beschäftigung mit der vergleichenden Neurophänomenologie so sehr wichtig für das Entwirren der Prozesse, die neben der Depression auch viele andere Störungen unseres emotionalen Lebens zum affektiven Horror machen. Dank der Methoden der affektiven Neurowissenschaften können wir heute eine Verbindungslinie zwischen John Bowlbys bahnbrechenden Überlegungen zur Genese der Depression und den spezifischen affektiven Netzwerken ziehen, die sich im kausalen Detail in unseren vorklinischen Tiermodellen studieren lassen.
Warum also tut die Depression weh? Dies ist unserer Ansicht nach aus zwei Gründen so, die beide mit der Empfindung nachlassender innerer Sicherheit zu tun haben: zum einen wegen ihres intrinsischen Zusammenhangs mit dem Trennungsschmerz, der uns dazu bringt, addiktive, also suchtähnliche Bindungen vor allem zu den frühen Bezugs- und Pflegepersonen, aber auch zu unseren erwachsenen Gefährten und Kindern und zu größeren sozialen Gruppen einzugehenund aufrechtzuerhalten . Wir sollten nicht vergessen, dass die gegenseitige Fellpflege bei den Primaten zur Ausschüttung von Hirnopioiden führt (Keverne et al. 1989, 1997) und dass unsere menschlichen Stimmen u. a. der freundlichen Kontaktpflege untereinander und dem wechselseitigen »Beziehungsaufbau« dienen. Zum zweiten: Eine Depression veranlasst uns, die Hoffnung aufzugeben, wenn unsere Bemühungen um Wiedervereinigung mit solchen Figuren oder Gruppen nicht innerhalb einer begrenzten Zeitspanne zum Erfolg führen und wir uns dadurch, psychologisch gesehen, von der Welt absetzen. Dieser anhaltende Verlust der affektiven Energie und die damit einhergehende »Sinnentleerung« könnten in einem engen Zusammenhang mit dem Nachlassen der SEEKING-Impulse stehen, ein Zustand, der, wie wir seit langem wissen, Ausgangspunkt aller ernsthaften Formen der Suchtmittelabhängigkeit ist. Mit einem Wort: Auf der neurochemischen Ebene sind wir denen, die wir lieben, suchtartig verbunden.
Auf dem Hintergrund der Existenz von Hirnstrukturen, die solche Gefühle hervorbringen, scheint die These gerechtfertigt, dass der Dreh- und Angelpunkt zumindest einer der bedeutsamen Formen von Depression nicht zu den Dingen gehört, für die sich die psychiatrische Forschung in den zurückliegenden drei Jahrzehnten besonders interessiert hätte; vielmehr hat sie sich mit dem evolutionär erhalten gebliebenen Hirnzustand befasst, der den Übergang vom Protest zur Verzweiflung im Nachgang sozialer Verlusterfahrungen vermittelt. Unserer Ansicht nach besteht ein enger Zusammenhang zwischen diesem Zustand und der nachlassenden Erregung des dopaminergen SEEKING-Systems. Mit anderen Worten: Die These scheint plausibel, dass die Depression letztlich auf den Prozess zurückzuführen ist, durch den Trennungsschmerz üblicherweise »heruntergefahren« wird (möglicherweise durch eine verringerte Erregung der Dopaminrezeptoren, verringerte Mü- und Delta- sowie erhöhte Kappa-Opioid-[Dynorphin-]Aktivität und verschiedene inflammatorische Zytokine, die Tiere und Menschen zum »Aufgeben« veranlassen), wenn das affektive Gehirn, welches unseren kognitiven Apparat unterstützt, mit Stress überfrachtet wird. Mit der Analyse der Details jener basisemotionalen Prozesse, die allen Säugetieren gemeinsam sind, bieten die affektiven Neurowissenschaften, neuerdings mit der Extension zu Therapieansätzen mit der Tiefen Hirnstimulation, neue Strategien, um solchen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken.
Anmerkung
1 Bislang unveröffentlichtes Originalmanuskript. Copyright am englischsprachigen Original bei Jaap Panksepp und Co-Autoren; die Autoren danken der Stiftung Hope for Depression Research , die diese Arbeit finanziell unterstützt hat.
Literatur
Anisman, H. & Matheson, K. (2005): Stress, depression, and anhedonia: Caveats concerning animal models. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29, S. 525 – 46.
Berger, M., Gray, J. A. & Roth, B. L. (2009): The expanded biology of serotonin. Annual Review of Medicine, 60, S. 355 – 66.
Bewernick, B. H., Hurlemann, R., Matusch, A., Kayser, S., Grubert, C., Hadrysiewicz, B., Axmacher, N., Lemke, M., Cooper-Mahkorn, D., Cohen, M. X., Brockmann, H., Lenartz, D., Sturm, V. & Schlaepfer, T. E. (2010): Nucleus accumbens deep brain stimulation decreases ratings of depression and anxiety in treatment-resistant depression. Biological Psychiatry , 67 (2), S. 110 – 116.
Bodkin, J.
Weitere Kostenlose Bücher