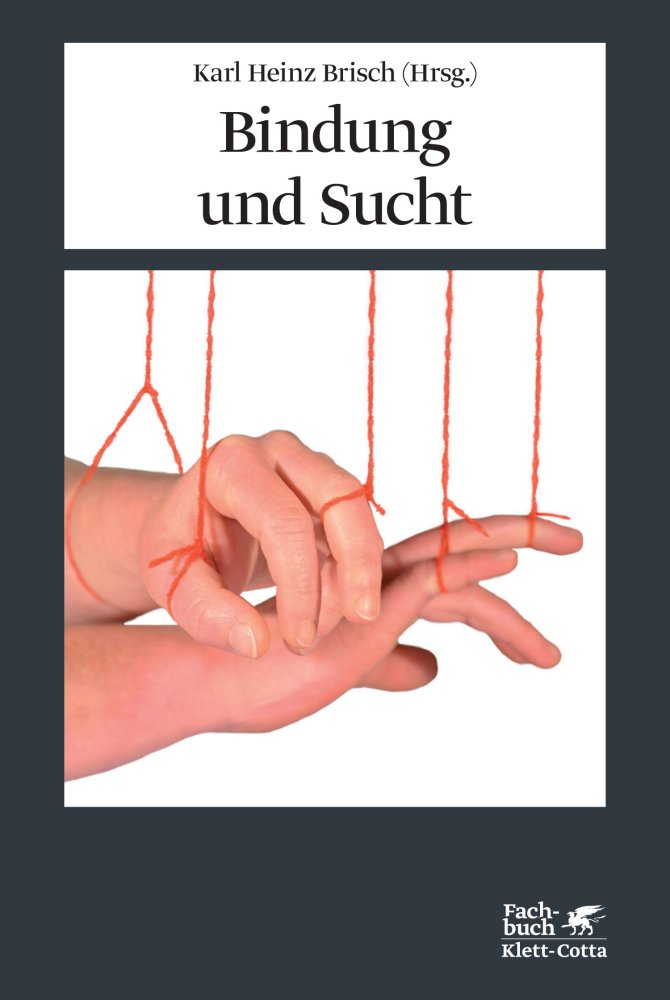![Bindung und Sucht]()
Bindung und Sucht
Sensibilität von Frauen zwar ihrer gesellschaftlichen Funktion als Mütter, erschwert jedoch berufliche Konkurrenzfähigkeit. Ein besserer Zugang zur eigenen Hilflosigkeit folgt aus der allgegenwärtigen Gewalt gegen Frauen, hilft jedoch gleichzeitig, diese aufrechtzuerhalten (Rommelspacher 2002). Eine instrumentelle und aggressive Orientierung erleichtert Männern zwar berufliche Durchsetzungsfähigkeit, sie sind jedoch im Gesundheits- und Beziehungsverhalten sehr viel gefährdeter als Frauen – bis hin zu einer deutlich geringeren Lebenserwartung (vgl. u. a. Hollstein 1992; Levant & Williams 2009; Spilles & Weidig 2004).
Unter den Faktoren, die eine positive Bewältigung komplexer Traumatisierung und Sucht begünstigen oder verhindern, nimmt der Umgang mit der eigenen Geschlechtsidentität daher in der Behandlung eine wichtige Rolle ein. Trotz steigenden Interesses in Forschung wie Fachliteratur an der Dyade aus Trauma und Sucht wird dieser Faktor jedoch bisher wenig berücksichtigt.
Gender, Trauma, Sucht und Bindung
Biologisches Geschlecht und »die Ausformung dessen, wie Geschlecht in einer bestimmten Kultur, in einer konkreten historischen Situation … interpretiert und gelebt wird bzw. gelebt werden soll« (Tatschmurat 2004, S. 231), sind voneinander zu unterscheiden. In der Genderforschung hat sich der Gebrauch der englischen Begriffe durchgesetzt: »Sex« für das (relativ) unveränderbare biologische Geschlecht und »Gender« für die jeweilige kultur-, schicht- und milieuspezifische Ausformung der Geschlechterrolle in einer jeweils individuellen Biografie. Bereits in der frühkindlichen Entwicklung bildet sich bei weiblichen und männlichen Kindern ein differentes, individuelles Genderkonzept heraus (Trautner 1991), das sich im Sozialisationsprozess in steter Auseinandersetzung mit der Umwelt über den gesamten Lebensverlauf weiterentwickelt (Faltermaier et al. 2002; Hurrelmann & Ulich 1998; Nestvogel 2010).
Die Herausbildung der Geschlechtsidentität wird in erster Linie durch das jeweilige kulturelle Geschlechtsverständnis geprägt (Hagemann-White 1984), wirkt aber auch wieder auf das gesellschaftliche System zurück (West & Zimmermann 1987; aktuell Gildemeister 2010). Die Geschlechtsidentität als Bewusstsein, ein männliches oder weibliches Individuum zu sein, und als Integration dieser Erkenntnis in das Selbstkonzept bleibt auf diese Weise stetig in Veränderung begriffen (Bilden 2001) und interagiert stetig mit weiteren Entwicklungsfaktoren, an erster Stelle Bindungsphänomenen und frühen traumatischen Einflüssen (siehe Abb. 1; zum Zusammenhang zwischen Geschlecht und Bindung in der Forschung vgl. Kasten 1, S. 238; zum Zusammenhang zwischen Gender, Trauma und Sucht im Lichte internationaler Forschung vgl. ausführlich Gahleitner 2012).
Es überrascht nicht, dass es in Bezug auf traumatische Erfahrungen und damit verknüpfte Bindungsphänomene zwischen Jungen und Mädchen in der frühesten Kindheit kaum Unterschiede gibt: Sind sie doch als Kinder zunächst auf ganz ähnliche Art und Weise Opfer einer Gewalttat oder Katastrophe geworden. Schwach und ohnmächtig zu sein passt jedoch nicht in unser gesellschaftlich vermitteltes Bild von Jungen. Umgekehrt hat ein aggressives, gewalttätiges Mädchen häufig schärfere Sanktionen zu erwarten als ein gleichaltriger Junge mit einem solchen Verhalten. In der Verarbeitung der Folgen tauchen daher im Kindes-, Jugendlichen- und Erwachsenenalter neben vielen Gemeinsamkeiten auch ausgeprägte Differenzen zwischen Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männern (Gahleitner 2005 b) auf.
Abb. 1: Die Interaktion von Gender – Trauma – Sucht und Bindung in der Entwicklung
----
EXKURS: Geschlecht und Bindung: Die Bindungsforschung hat bisher überraschend wenig geschlechtsspezifische Ergebnisse produziert, rekurriert sie doch auf ein universelles, übergreifendes evolutionäres Entwicklungsprinzip. In den Anfängen der Bindungsforschung bei Bowlby (1973, 2005, 2006) und Ainsworth und Wittig (1969) finden sich dazu keine Ausführungen bzw. konnten in Bezug auf Bindung keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen festgestellt werden. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Bindungsforschumg erst in den letzten Jahren auch mehr und mehr späteren Lebensaltern und erweiterten Zusammenhängen geöffnet hat. Einige aktuelle (Karairmak & Duran 2008; Morsünbül 2009) und einige ältere Studien (Feeney 1999; Kirkpatrick & Davis 1994; Robin, 2003; Schmitt et al.,
Weitere Kostenlose Bücher