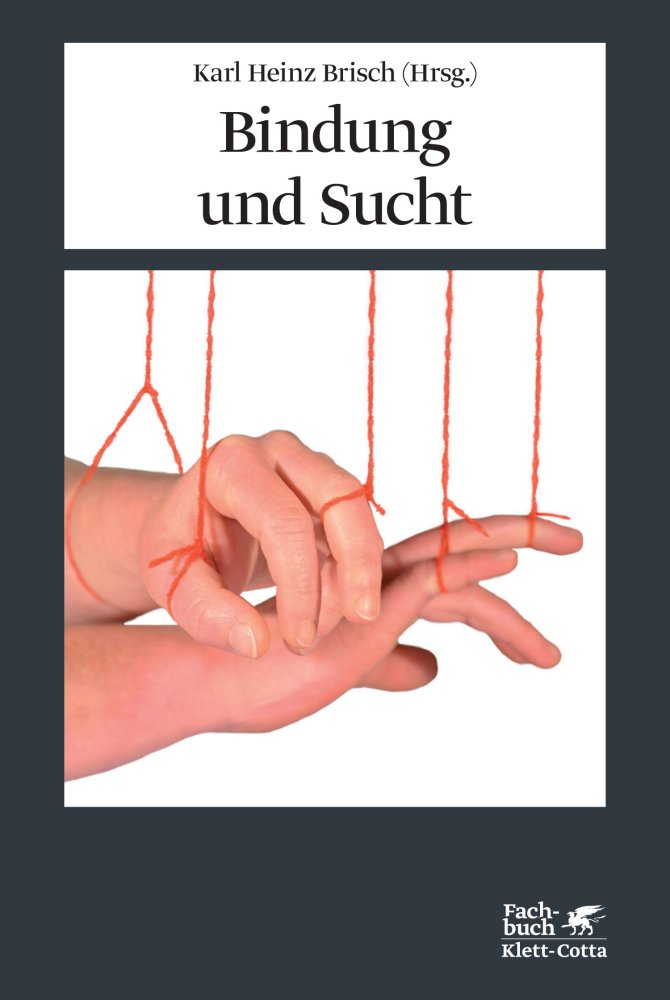![Bindung und Sucht]()
Bindung und Sucht
2003) allerdings zeigen Geschlechtsunterschiede in den Bindungsstilen auf. Übereinstimmend wird jedoch auch aktuell die schlechte Forschungslage zu diesem spezifischen Thema hervorgehoben. Die Ergebnisse sind zudem z. T. sehr widersprüchlich. Während einige Untersuchungen mit einem Instrument von Hazan und Shaver (1987) keine Unterschiede feststellten (Brennan et al. 1991; Feeney & Noller 1990; Hazan & Shaver 1987; Levy & Davis 1988), fanden Mickelson, Kessler und Shaver (1997) einen höheren Anteil sicher gebundener Frauen und eine größere Häufigkeit vermeidend gebundener Männer. Allerdings kamen Cooper, Shaver und Collins (1998) zu exakt dem gegenteiligen Ergebnis.
Die Ergebnisse scheinen z. T. auch davon abhängig zu sein, welche Instrumente dabei genutzt werden (Fox 2002). In einer Untersuchung mit 500 Kindern fanden Pierrehumbert et al. (2009) beim Einsatz des Attachment Story Completion Task (ASCT), dass die Narrative von Mädchen länderübergreifend sicherer erschienen als die der Jungen. Allerdings zeigte sich dieses Phänomen von Land zu Land unterschiedlich (vgl. auch Richaud de Minzi 2010). Ross (2008) fand in einer Stichprobe von 224 Studierenden nicht nur Geschlechterdifferenzen, sondern untersuchte zugleich das Untersuchungsinstrument auf eine geschlechtsneutrale Sprache. Im Ergebnis wird das Instrument an vielen Punkten als »genderlastig« eingeschätzt.
Mehr als mit Geschechtsspezifika in den Bindungsmustern hat man sich mit geschlechtsspezifischen Aspekten in Paarkonstellationen beschäftigt (Ross 2008). So scheinen am seltensten solche Paare zusammenzufinden, bei denen der Mann einen ambivalenten und die Frau einen vermeidenden Bindungsstil aufweist, während dies umgekehrt häufiger der Fall ist (Feeney et al. 1993). Betrachtet man Untersuchungen zu männlichen und weiblichen Geschlechtsstereotypen (vgl. u. a. Sieverding 1997), könnte man auch eine leichte Tendenz der Bindungsorganisationen erwachsener Menschen ganz allgemein in diese Richtung – Mann mit vermeidendem, Frau mit ambivalentem Bindungsstil – vermuten. Vermeidende Bindungsmodi passen einfach viel besser zum klassischen Geschlechtsstereotyp des »Marlboro-Mannes« (Sieverding 1997). Für exaktere Verknüpfungen jedoch ist hier die Forschungslage einfach noch zu dünn.
----
Kasten 1: Zusammenhang zwischen Geschlecht und Bindung in der Forschung
Gerade in Krisenzeiten, nach kritischen Lebensereignissen oder traumatischen Erfahrungen, sind Menschen zur Orientierung auf vorgegebene Strukturen und Symbolsysteme besonders stark angewiesen (Stecklina & Böhnisch 2004). Genderschemata gehören zu den »Prototypen sozialer Klassifikation« (Goffman 1994, S. 108). Es erstaunt daher nicht, dass es in der Folge fortgesetzter Traumaerfahrung und Suchtproblematiken häufig zu einer »destruktiven Geschlechtsextremisierung« (Gahleitner 2005 b) in Form weiblicher Opferschaft und Reviktimisierung und männlicher Täterschaft kommt, die uns im Klinik- und Justizkontext vor große Herausforderungen stellt (vgl. auch Teunißen & Engels 2006, 2009). Die Auswirkungen und die jeweilige spezifische Ausgestaltung der Genderrollen werden allerdings häufig erst lange nach der Traumatisierung im Sozialisationsprozess bzw. in der weiteren Verarbeitung deutlich und können daher häufig durch die Betroffenen selbst der traumatischen Erfahrung nicht zugeordnet werden.
Diese Zuordnungsschwierigkeit hat etwas mit dem Phänomen der Komorbidität von Trauma und Sucht zu tun. Häufig sind Suchtphänomene nach traumatischen Erfahrungen zunächst als Bewältigungsversuche zu verstehen, die sich erst mit der Zeit chronifizieren. Diesen Prozess lohnt es, eingehender geschlechtsspezifisch zu betrachten (vgl. im Folgenden, wenn nicht anders verwiesen, die zugrunde liegende Studie Gahleitner 2005 b; aktuell an zwei Fallbeispielen und im Lichte internationaler Forschung Gahleitner, im Druck). Konzeptualisert man das Geschehen Gender – Trauma – Sucht von der – zumeist im Vorlauf erfolgten – traumatischen Erfahrung aus, versuchen Männer wie Frauen nach einer kurzen Initialreaktion und unangenehmen intrusiven Belastungen häufig, das Trauma vermeidend zu kompensieren. Diese Versuche erfolgen in der Regel unbewusst, sind häufig geschlechtsspezifisch geprägt und können zahlreiche symptomatische Formen annehmen, etwa harten Drogenmissbrauch, Täteranteile oder -fantasien und aggressives Verhalten bei Männern und (Auto-) Aggression, psychosomatische
Weitere Kostenlose Bücher