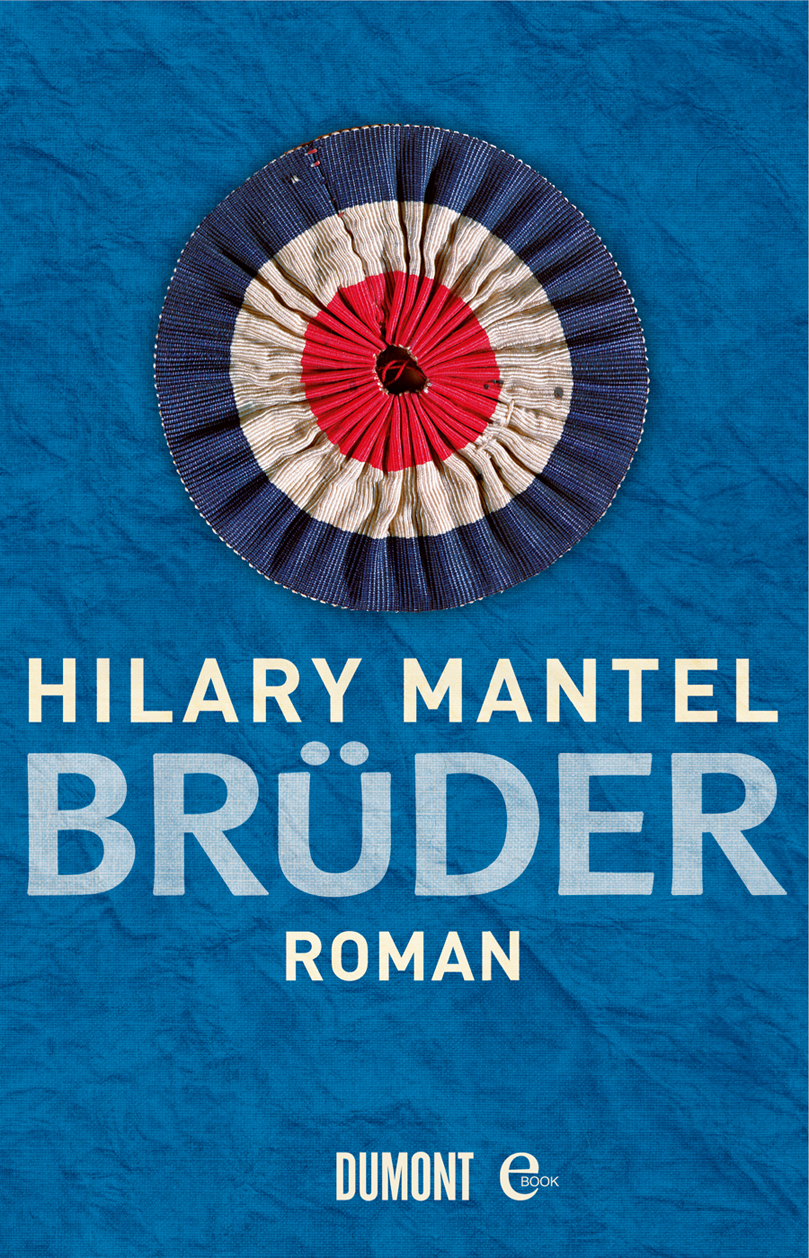![Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety]()
Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety
dass Camille das Leben seiner Mitmenschen zerstörte. Camille begriff nicht, wie jemand das finden konnte. Er hatte niemanden vergewaltigt, er hatte keinen Mord begangen – und alles andere sollten die Leute gefälligst wegstecken und weitermachen, so wie er das auch ständig tat.
Ein Brief kam, von zu Hause. Er mochte ihn nicht öffnen. Dann sagte er sich, sei nicht albern, jemand könnte gestorben sein. In dem Kuvert lag ein Bankwechsel, dazu ein paar Zeilen von seinem Vater, weniger Abbitte als vielmehr Resignation. Es war nicht das erste Mal, sie hatten diesen ganzen Zyklus schon mehrmals durchlaufen: die Beschimpfungen, das Grauen, die Flucht, die versöhnliche Geste. Ab einem bestimmten Punkt packte seinen Vater die Angst, zu weit gegangen zu sein. Er wollte, er musste die Kontrolle über alles haben, und wenn sein Sohn nicht mehr schrieb, nie mehr nach Hause zurückkehrte, dann hätte er die Kontrolle verloren. Ich sollte den Wechsel retournieren, dachte Camille. Aber wie üblich brauche ich das Geld, und das weiß er. Vater, dachte er, warum quälst du nicht zur Abwechslung einmal deine anderen Kinder?
Ich gehe auf einen Sprung bei d’Anton vorbei, sagte er sich. Georges-Jacques wird mit mir reden, er hält mir meine Laster nicht vor, er hat vielleicht sogar seine Freude daran. Der Tag schien ihm gleich weniger trüb.
In d’Antons Kanzlei herrschte Hochbetrieb. Der königliche Rat beschäftigte dieser Tage zwei Kanzlisten. Der eine war ein Mann namens Jules Paré, den er noch aus Schulzeiten kannte, wobei d’Anton einige Jahre jünger war; es schien nichts Seltsames mehr daran, dass er Angestellte hatte, die älter waren als er. Der andere hieß Deforgues, und auch ihn kannte d’Anton schon seit Ewigkeiten. Dann gab es noch einen dritten Mann, Billaud-Varennes, der bei Bedarf aushalf, Formschreiben abfasste und sonstige Routinearbeit verrichtete, zu der die anderen nicht kamen. Auch er war heute Morgen da, ein dürrer, unansehnlicher Geselle, der für niemanden ein freundliches Wort übrig hatte. Als Camille hereinkam, schichtete Billaud an Parés Schreibtisch Papierbögen aufeinander und beschwerte sich dabei über die Gewichtsprobleme seiner Frau. Er schien in besonders gehässiger Stimmung; kein Wunder, dachte Camille, so heruntergekommen und schäbig, wie er aussah – und dann Georges-Jacques vor der Nase zu haben, mit seinen feinen, schön gebürsteten Wollstoffen und den schlichten, blendend weißen Halsbinden, seiner generellen Aura von Betuchtheit und dieser lauten, kultivierten Stimme … »Warum beschweren Sie sich über Anna«, fragte Camille, »wenn Ihnen in Wahrheit Maître d’Anton aufstößt?«
Billaud blickte hoch. »Mir stößt gar nichts auf.«
»Wie schön für Sie. Sie müssen der einzige Mann in ganz Frankreich sein, dem nichts aufstößt. Warum lügt er?«
»Verzieh dich, Camille.« D’Anton nahm die Papiere von Billaud entgegen. »Ich hab zu tun.«
»Vor deiner Aufnahme ins Advokatenkolleg, musstest du da nicht zu deinem Gemeindepriester gehen und dir eine Bestätigung ausstellen lassen, dass du ein guter Katholik bist?« D’Anton grunzte, ganz vertieft in seine Gegenforderungen. »Ist dir das nicht aufgestoßen?«
»Paris ist eine Messe wert«, sagte d’Anton.
»Nur deshalb zeigt unser Maître Billaud-Varennes ja so wenig Ehrgeiz über seine derzeitige Position hinaus. Er wäre auch gern königlicher Rat, aber zu so etwas kann er sich denn doch nicht überwinden. Er hasst Priester, stimmt’s?«
»Stimmt«, sagte Billaud. »Und wenn wir schon zitieren, wie wär’s mit folgendem Zitat: ›Ich wünsche mir, und das soll der letzte und glühendste meiner Wünsche sein, ich wünsche mir, den letzten König an den Gedärmen des letzten Priesters aufgeknüpft zu sehen.‹«
Ein kurzes Schweigen. Camille maß Billaud mit den Blicken. Er hatte den Mann noch nie ausstehen können, mochte kaum im selben Raum mit ihm sein, die Haare stellten sich ihm auf vor Abneigung und einer Beklemmung, die er nicht einordnen konnte. Aber das war der springende Punkt – er musste im selben Raum mit ihm sein. Er musste die Gesellschaft von Menschen suchen, gegen die sich alles in ihm sträubte, es war zu einem Zwang geworden. Er schaute gewisse Leute an, und es war, als würde er sie schon immer kennen, als gehörten sie irgendwie zu ihm, als wären sie mit ihm verwandt.
»Was macht Ihr subversives Pamphlet?«, fragte er Billaud. »Haben Sie inzwischen einen Drucker dafür?«
D’Anton
Weitere Kostenlose Bücher