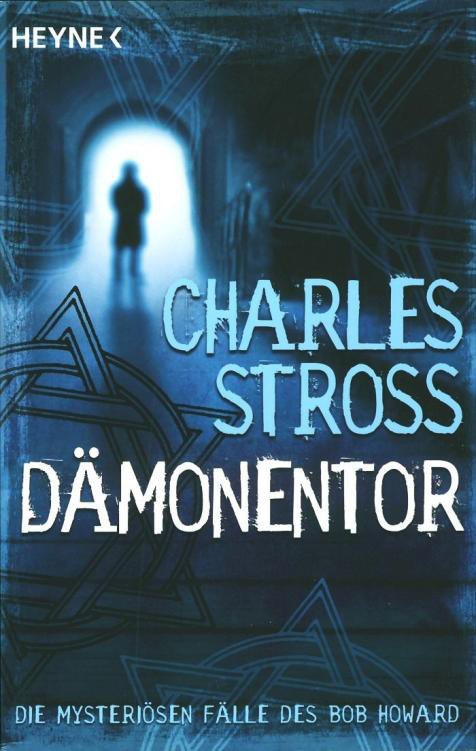![Dämonentor]()
Dämonentor
»– diesmal sieht die Sache anders aus.«
Ich bemerke, wie sich draußen etwas bewegt; obwohl es nicht mehr als ein
Schatten hinter der Scheibe ist, erkenne ich das Gesicht, ehe es wieder
verschwindet.
»Sieht ganz so aus«, murmele ich und fühle mich
schuldig.
»Deine Chefs hatten also die Idee, mich in der Öffentlichkeit
beschatten zu lassen und zu sehen, was sich daraus ergibt. Währenddessen
versuchen wir, die Männer anhand der Beweisstücke aus dem Museum zu
identifizieren«, fährt sie fort. »Wie viele Leute beobachten uns, Bob?«
»In diesem Augenblick mindestens einer«, erwidere ich.
Mein Herz pocht wie verrückt. »Soviel ich weiß. Sie arbeiten rund um die Uhr,
sodass wir ununterbrochen von Sicherheitsleuten beobachtet werden, ohne es
selbst zu merken. Fast wie Politiker, die auf einer Abschussliste stehen.«
Hastig füge ich hinzu: »Wir erwarten natürlich keine Selbstmordattentäter.«
Sie lächelt mich warm an. »Das beruhigt mich ungemein.
Da fühle ich mich doch gleich viel sicherer.«
Ich zucke innerlich zusammen. »Hättest du einen
Alternativvorschlag?«
»Nicht aus der Sicht deines Chefs. Wie heißt er noch
mal? Angleton? Nicht aus seiner Sicht. Nein, wahrscheinlich gibt es keine Alternative.«
Ohne ein Geräusch zu verursachen, taucht eine Bedienung auf und räumt unsere
Teller ab. Mo blickt mich mit einem Ausdruck an, den ich nicht deuten kann.
»Und was machst du hier, Bob?«
»Ich …« Ich überlege einen Moment, wie ich ihr das am
besten erklären kann. »Es ist mein Schlamassel. Ich bin immer tiefer
hineingeraten, weil ich mich in Kalifornien nicht an das Protokoll gehalten
habe. Und als die Dinge dann so geheim wurden, dass man kaum mehr atmen durfte,
ohne vorher eine Verschwiegenheitsklausel zu unterschreiben, war ich schon
mittendrin. Außerdem gibt es einen Machtkampf zwischen dem Management und den
Außendienstlern –«
»Das meine ich nicht.« Sie schweigt und fügt dann
hinzu: »Warum hast du dich in Santa Cruz nicht an die Spielregeln gehalten?
Nicht, dass ich etwas dagegen gehabt hätte, aber –«
»Weil –« Ich betrachte eingehend mein Weinglas. »Ich
mag dich. Und ich finde nicht, dass ich Leute, die ich mag, dem sicheren Tod
überlassen sollte. Außerdem habe ich, ehrlich gesagt, auch keine sonderlich
professionelle Arbeitseinstellung. Zumindest nicht in den Augen der anderen
Agenten.«
Sie beugt sich nach vorn. »Und inzwischen bist du
professioneller geworden?«
Ich schlucke. »Nein, eigentlich nicht.«
Ein Fuß streicht sanft über meinen Knöchel, und ich
zucke erschreckt zusammen. »Gut.« Sie lächelt mich auf eine Weise an, die meine
Eingeweide zum Kribbeln bringt. Ehe ich etwas erwidern kann, taucht ein Kellner
mit einer Unzahl von Tellern auf, die er elegant balancierend auf unseren Tisch
stellt. So kann ich mich wenigstens nicht blamieren. Wir schauen einander
wortlos an, bis der Kellner alles abgestellt hat. Dann fügt sie hinzu: »Ich
hasse es, wenn man Professionalität über das richtige Leben stellt.«
Während des Essens unterhalten wir uns über alles
Mögliche. Mo erzählt mir von ihrer Ehe mit einem New Yorker Anwalt, und ich
drücke natürlich mein Mitgefühl aus, woraufhin sie sich erkundigt, wie sich das
Leben mit einer manisch-depressiven Superzicke gestaltet. Offensichtlich hat
sie bereits mit Pinky und Brain über Mhari gesprochen, denn ich merke, wie frei
ich über das Ganze reden kann – ganz so, als ob ich das bereits alles hinter
mir gelassen hätte. Mo nickt und fragt, ob es nicht sehr peinlich wäre, Mhari
zufällig in der Buchhaltung zu treffen, was zu einem längeren Gespräch über das
Dasein in der Wäscherei führt, wo alles mit irgendwelchen Peinlichkeiten zu tun
hat – angefangen mit den Büroklammerrevisionen. Ich erzähle ihr von meiner
Hoffnung, eine Versetzung zum Außendienst würde mich aus dieser Hölle und
insbesondere von Bridget befreien, und wie ich mich da getäuscht habe. Mo hat
ebenfalls einige solcher Berufserfahrungen gesammelt und berichtet mir von den
internen Machtkämpfen an Amerikas Universitäten und warum man weder zu viel
noch zu wenig publizieren darf. Außerdem klärt sie mich darüber auf, wie zwei
berufstätige Erwachsene, die sich irgendwann mal geliebt haben, einander
beinahe in den Wahnsinn treiben können. Vielleicht war das mit Mhari und mir
also gar nicht so ungewöhnlich?
Auf dem Weg zurück zum Hotel gehen wir Arm in Arm und
unter einer kaputten Straßenlaterne bleibt sie stehen,
Weitere Kostenlose Bücher