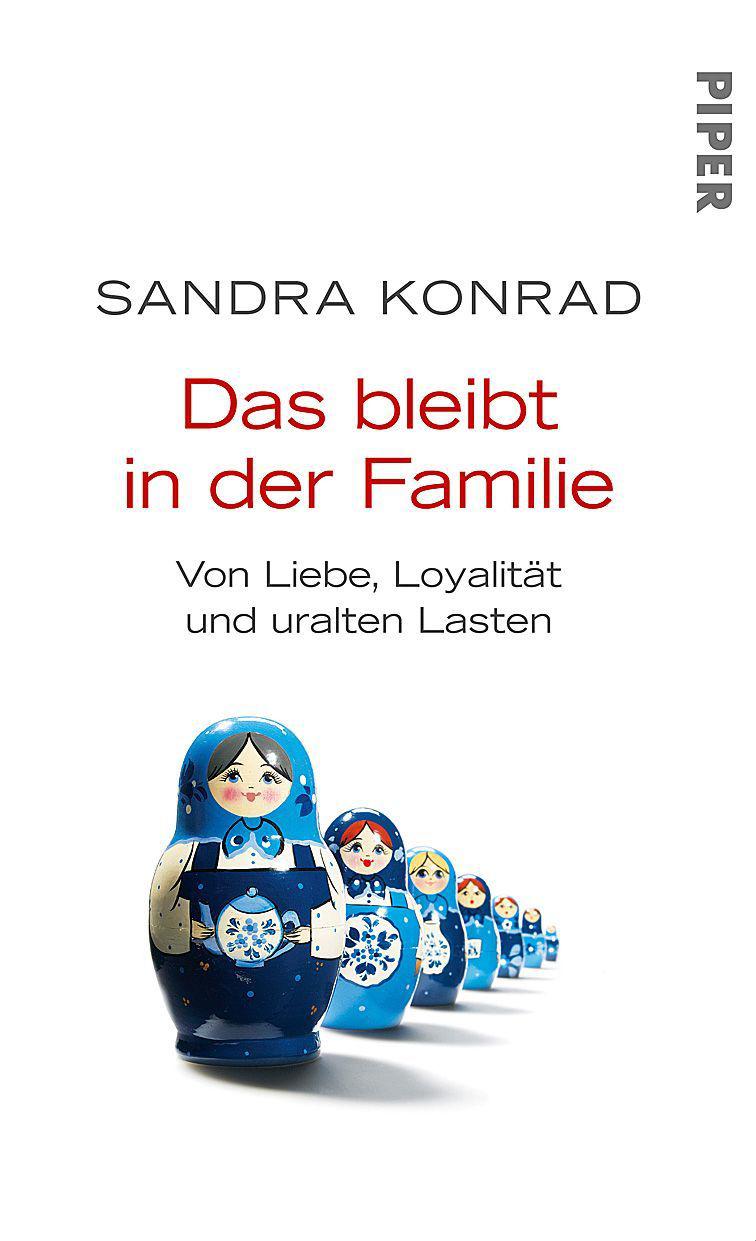![Das bleibt in der Familie: Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten (German Edition)]()
Das bleibt in der Familie: Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten (German Edition)
tief verwurzelten hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung,
sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen.«
HANNAH ARENDT , »Besuch in Deutschland«
Unterdrückte und abgewehrte Gefühle spielen eine bedeutende Rolle in der deutschen Gesellschaft, die während des Nationalsozialismus große Schuld auf sich geladen hatte. Die Schuldgefühle, die gesellschaftlich verordnet, aber persönlich abgewehrt wurden, hinderten die Deutschen jahrzehntelang daran, sich mit ihrer Trauer zu beschäftigen. Stattdessen galten »Funktionieren« und »Nach-vorn-Schauen« als wichtigste Leitlinien. Die Kriegstraumatisierungen und die Verluste wurden wie alles andere totgeschwiegen und oft erst von den Folgegenerationen emotional erfasst.
In der Öffentlichkeit war es lange Zeit undenkbar, auch bei den Tätern Opferanteile wahrzunehmen und zu benennen. Die Gefahr einer Geschichtsmathematik, in der das Leid der Täter gegen das Leid der Opfer aufgerechnet werden würde, schien zu hoch. Und tatsächlich ist die emotionale Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bis heute so schwierig, weil die deutsche Täterschaft und die dazugehörigen Schuld- und Schamgefühle innerfamiliär oft massiv abgewehrt werden.
Solange diese Verleugnung der Schuld anhält, wird gleichermaßen das Leid der Opfer verleugnet oder bagatellisiert. Und das von den Deutschen erhobene Anrecht auf »Wir haben auch gelitten« erzeugt nachvollziehbarerweise Wut und Ohnmacht aufseiten der Opfer.
In diesem Konflikt nimmt es nicht wunder, dass die erste deutsche Gruppe, die sich ihren Kriegswunden vorsichtig nähern durfte, Kriegs kinder waren, die aufgrund ihres Alters unmöglich Täter gewesen sein konnten. Ihre traumatischen Erfahrungen – der Hunger, die Bombennächte, der Verlust ihrer Kindheit, der Verlust ihrer Väter oder beider Eltern, Flucht und Vertreibung – wurden seither erforscht und der Öffentlichkeit präsentiert. Peu à peu nahmen Wissenschaft und Medien auch andere Gruppen von Kriegsgeschädigten in den Blick: traumatisierte Soldaten, Flüchtlinge und Vergewaltigungsopfer, Kriegswaisen, Bombenopfer, Heimkehrer – Kollateralschäden des selbst verschuldeten Krieges.
Mittlerweile wissen wir viel über die transgenerationalen Auswirkungen der Zweiten-Weltkriegs-Traumata, auch beim deutschen Tätervolk. Wir wissen, dass die Abwesenheit der Väter für die Soldatenkinder genauso prägend war wie deren Rückkehr als Fremde. Wir wissen, dass Existenz- und Verlustängste von Flüchtlingen auf ihre Kinder übertragen wurden und dass abgewehrte Trauer Einfluss auf das emotionale Erleben der Folgegenerationen hat. Wir wissen, dass die nationalsozialistische Ideologie nach dem Zweiten Weltkrieg oftmals nicht neu bewertet oder verworfen wurde, sondern sich in den Köpfen und Herzen vieler Deutscher festgesetzt hatte, was einen anhaltenden Rassismus und Antisemitismus nach sich zog und nicht zuletzt auch Auswirkungen auf die Erziehung der Nachkriegsgeneration hatte.
Wenn sich unverarbeitete Gefühle in den Folgegenerationen seelisch abbilden, was geschah dann eigentlich mit der Schuld, die nicht gefühlt werden wollte? Kann Schuld ebenso wie die Übertragung eines Traumas zu psychischen Problemen führen?
Die Antwort ist nicht gerecht: Die Opfer des Holocaust und ihre Familien leiden stärker und nachhaltiger unter ihren Erfahrungen als die Täter und deren Nachkommen. Während sich die Erfahrung, Opfer geworden zu sein, auch über Generationen hinweg nicht abschütteln lässt und das Sicherheitsgefühl der Überlebendenfamilien bis heute beeinträchtigt, verfügen nationalsozialistische Täter und ihre Nachkommen oft über hochwirksame psychische Abwehrstrategien wie Verleugnung, Bagatellisierung und Verdrängung. Anders gesagt: Wer sich nicht schuldig fühlt, kann auch keine Schuld vererben. Diese Regel scheint für die meisten deutschen »Täterfamilien« zu gelten, in denen die Schuldabwehr und Mythenbildung nachweislich bestens funktioniert, auch, weil die überwiegende Mehrheit der an NS-Verbrechen beteiligten Täter straffrei ausging.
Dennoch gibt es Familien, in denen sich die Schuld der Eltern im Leben der Kinder abzeichnete. Hierbei handelte es sich allerdings meist weniger um eine Übertragung von elterlichen Scham- und Schuldgefühlen, sondern eher um eine persönliche Reaktion auf die Verleugnung, um eine eigene Bewertung der Vergangenheit.
Die Last der Kinder berühmter Nazis
»Denn da wir nun einmal die Resultate früherer
Weitere Kostenlose Bücher