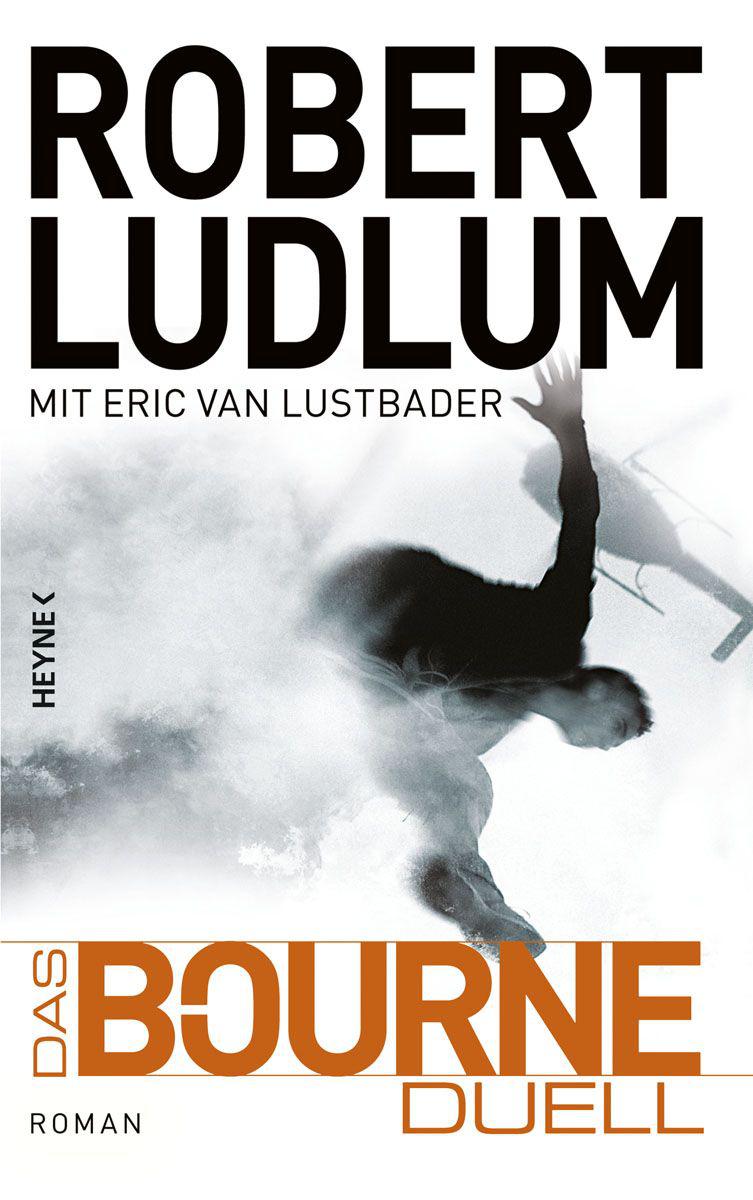![Das Bourne Duell]()
Das Bourne Duell
alles.«
Sie brachten Moira in die Notaufnahme. Während sich das Personal um sie kümmerte, fragte Soraya nach dem besten Neurochirurgen in Sonora. Sie sprach sehr gut Spanisch und sah noch dazu wie eine Latina aus – und das öffnete hier so manche Tür. Sie bekam die Privatnummer des Chirurgen und rief ihn sofort an. Sein Assistent behauptete, er sei nicht erreichbar, doch als Soraya ihm androhte, vorbeizukommen und ihm den Hals umzudrehen, überlegte er es sich noch einmal. Der Chirurg meldete sich wenig später. Soraya beschrieb ihm Moiras Verletzung und sagte ihm, wo sie waren. Als sie ihm zweitausend amerikanische Dollar im Voraus versprach, war er bereit, sofort zu kommen.
»Gehen wir«, sagte Arkadin, als sie das Gespräch beendet hatte.
»Ich lasse Moira nicht allein.«
»Wir haben noch ein paar Dinge zu besprechen.«
»Das können wir auch hier tun.«
»Nein – im Kloster.«
»Ich werde nicht mit dir schlafen«, sagte sie.
»Gott sei Dank, das wäre nämlich so, als würde ich mit einem Skorpion schlafen.«
Die Ironie seiner Bemerkung brachte sie zum Lachen, trotz ihrer Sorgen und ihrer verzweifelten Lage. Sie ging los, um sich einen Kaffee zu holen, und er folgte ihr.
Bourne fuhr zügig nach Oxford, aber nicht zu schnell, um nicht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu
ziehen. Er parkte in der Nähe der Stelle, wo Chrissie ihren Range Rover abgestellt hatte, als sie zusammen hier gewesen waren, und stieg die Stufen zum Centre for the Study of Ancient Documents hinauf. Er fand Professor Liam Giles dort, wo er auch beim letzten Mal war – über den Schreibtisch in seinem geräumigen Büro gebeugt. Er blickte auf, als Bourne eintrat, und blinzelte wie eine Eule, als würde er ihn nicht wiedererkennen. Erst jetzt sah Bourne, dass es gar nicht Giles war, sondern ein Mann etwa im gleichen Alter und von ähnlicher Statur.
»Wo ist Professor Giles?«
»Im Urlaub«, antwortete der Mann.
»Ich muss ihn sprechen.«
»Das hab ich mir schon gedacht. Darf ich fragen, warum?«
»Wo ist er?«
Der Mann blinzelte erneut. »Nicht da.«
Bourne hatte unterwegs die Webseite der Universität konsultiert, um Informationen über Giles einzuholen.
»Es geht um seine Tochter.«
Der Mann hinter Giles’ Schreibtisch blinzelte. »Ist sie krank?«
»Das darf ich Ihnen nicht sagen. Wo finde ich Professor Giles?«
»Ich glaube nicht …«
»Es ist dringend«, beharrte Bourne. »Es geht um Leben und Tod.«
»Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen, Sir?«
Bourne zeigte dem Mann den Ausweis, den er aus dem Krankenwagen hatte mitgehen lassen. »Ich meine es absolut ernst.«
»Du meine Güte.« Der Mann zeigte zur Tür. »Er ist gerade am Klo. Wahrscheinlich ist ihm die Aalpastete nicht bekommen, die er gestern Abend gegessen hat.«
Der Neurochirurg war jung, so dunkel wie ein indianischer Ureinwohner und hatte die langen schlanken Finger eines Pianisten. Er hatte ausgesprochen feine Gesichtszüge, was nicht auf eine indianische Herkunft schließen ließ. Doch er war ein beinharter Geschäftsmann und wartete, bis Soraya ihm eine dicke Rolle Geldscheine in die Hand drückte, ehe er sich an die Arbeit machte. Er besprach sich mit den Ärzten der Notaufnahme, die Moira versorgt hatten, während er zum OP-Saal ging.
Soraya trank ihren ungenießbaren Kaffee, ohne etwas zu schmecken, doch nachdem sie zehn Minuten sinnlos auf dem Gang auf und ab gegangen war, spürte sie ein Loch im Magen, und so stimmte sie sofort zu, als Arkadin vorschlug, etwas essen zu gehen. Sie fanden ein Restaurant nicht weit vom Krankenhaus entfernt. Sie bestellten ihr Essen, dann saßen sie einander gegenüber, ohne sich anzusehen, zumindest Soraya blickte woandershin.
»Ich hab dich vorhin ohne T-Shirt gesehen«, sagte Arkadin, »das war ein hübscher Anblick.«
Soraya wandte sich ihm zu. »Fuck you.«
»Sie war mein Feind«, sagte er, um zu rechtfertigen, was er mit Moira gemacht hatte. »So etwas nehme ich sehr persönlich.«
Soraya starrte durch das Fenster auf eine Straße hinaus, die ihr so fremd war wie die dunkle Seite des Mondes.
Das Frühstück kam, und Arkadin begann zu essen. Soraya sah zwei junge Frauen übertrieben geschminkt und spärlich bekleidet zur Arbeit gehen. Es erstaunte sie immer wieder, wie freizügig die Latinas ihren Körper zeigten. Ihre Kultur war so weit von der ihren entfernt. Was sie jedoch gut nachempfinden konnte, war diese Hoffnungslosigkeit, die man hier oft spürte. Das war ein
Weitere Kostenlose Bücher