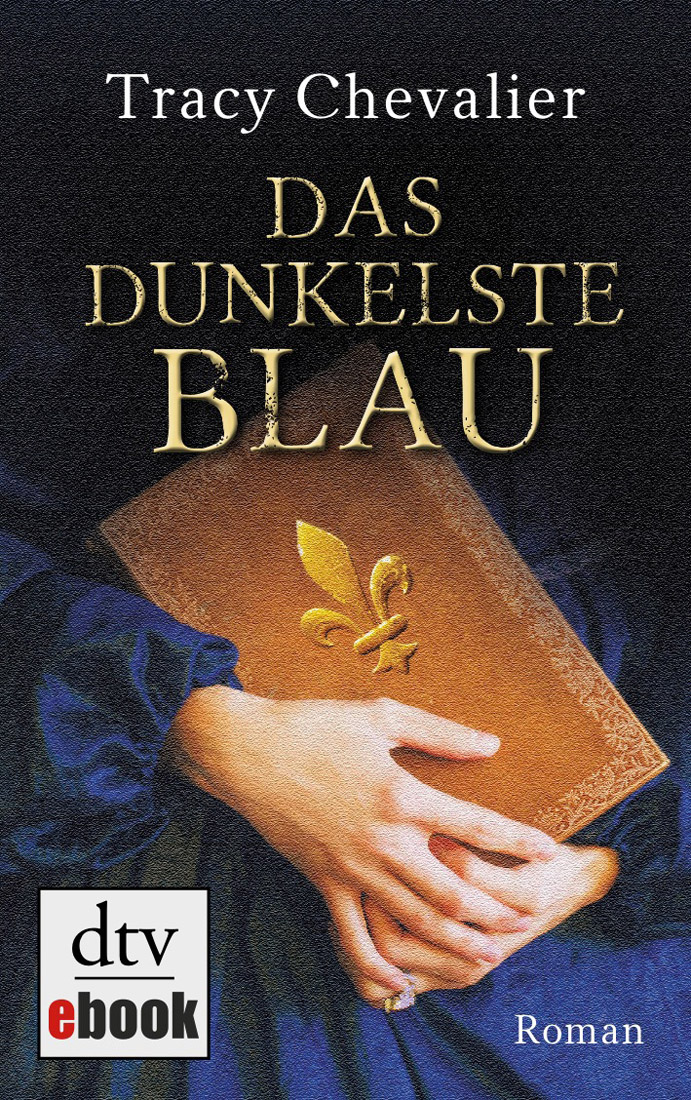![Das dunkelste Blau]()
Das dunkelste Blau
machte ihn nervös. Er hörte nicht auf, mir gute Tips zu geben, was für nützliche Dinge ich tun könnte. Seine Sorge trug nur noch zu meiner eigenen bei: Ich war nicht an soviel freie Zeit gewöhnt – immer war ich beschäftigt gewesen, entweder in der Ausbildung oder mit langen Arbeitszeiten. Daß ich jetzt plötzlich Zeit hatte, forderte einige Gewöhnung. Ich durchlief erst einmal eine Phase des späten Aufstehens und Herumhängens, bevor ich mir drei Projekte vornahm, um mich zu beschäftigen.
Zunächst begann ich an meinem verschütteten Französisch zu arbeiten und nahm zweimal in der Woche Stunden in Toulouse bei Madame Sentier, einer älteren Dame mit klugen Augen und einem schmalen Vogelgesicht. Sie hatte einen wohlklingenden Akzent, und als erstes nahm sie sich meinen vor. Schlampige Aussprache war ihr verhaßt, und sie wies mich scharf zurecht, wenn ich anfing, oui in dieser wegwerfenden Art vieler Franzosen zu sagen, wobei man die Lippen kaum bewegt und der Ton, der herauskommt, wie das Quaken einer Ente klingt. Sie brachte mir bei, es präzise auszusprechen und alle drei Buchstaben klingen zu lassen, so daß am Ende die Luft zwischen den Zähnen zischte. Sie bestand darauf, daß es wichtiger war, wie ich die Dinge sagte, als was ich sagte. Ich versuchte, ein paar Einwände gegen ihre Prioritäten geltend zu machen, aber ich war kein ebenbürtiger Gegner für sie.
»Wenn Sie die Worte nicht gut aussprechen, wird kein Mensch verstehen, was Sie sagen«, erklärte sie. »Noch schlimmer, die Leute werden merken, daß Sie Ausländerin sind, und Ihnen nicht zuhören. Die Franzosen sind so.«
Ich verkniff mir, sie darauf hinzuweisen, daß auch sie Französin war. Trotzdem mochte ich sie, mochte ihre Ansichten und ihre strenge Art, also machte ich ihre Mundübungen mit und dehnte meine Lippen, als wären sie aus Kaugummi.
Sie hielt mich dazu an, soviel wie möglich zu sprechen, egal wo ich war. »Wenn Sie etwas denken, sagen Sie es!« rief sie. »Egal, was es ist, egal, wie unbedeutend, sagen Sie es. Sprechen Sie mit allen Leuten.« Manchmal befahl sie mir, eine bestimmte Zeit lang zu sprechen, sie begann mit einer Minute und ließ mich dann bis zu fünf Minuten lang plappern. Ich fand es anstrengend und unmöglich.
»Sie denken auf englisch, und dann übersetzen Sie Wort für Wort ins Französische«, erklärte Madame Sentier. »So funktioniert Sprache nicht. Sie hat eine höhere Form. Was Sie tun müssen, ist, auf französisch denken . Sie sollten kein Englisch im Kopf haben. Denken Sie auf französisch, soviel wie möglich. Wenn Sie nicht in größeren Passagen denken können, dann denken Sie in Sätzen, wenigstens in Worten. Bauen Sie es zu großen Gedanken auf!« Ihre Geste schien den gesamten Raum und den gesamten menschlichen Intellekt zu umfassen.
Sie freute sich, als sie hörte, daß ich Verwandte in der Schweiz hatte; sie bestand darauf, daß ich ihnen schreiben sollte. »Sie könnten ursprünglich aus Frankreich stammen, wissen Sie«, sagte sie. »Es wäre gut für Sie, etwas über Ihre französischen Vorfahren zu erfahren. Sie werden sich mit diesem Land und seinen Bewohnern sofort stärker verbunden fühlen. Es wird Ihnen dann auch nicht so schwerfallen, auf französisch zu denken.«
Innerlich zuckte ich die Achseln. Stammbaumforschung gehörte zu den Dingen, mit denen man sich im vorgerückten Alter befaßte; es war wie mit Radiowunschkonzerten, Stricken und zu Hause verbrachten Samstagabenden: Wahrscheinlich würde ich das alles auch irgendwann mal tun, aber besonders eilig hatte ich es damit nicht. Meine Vorfahren hatten nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun. Aber um Madame Sentier einenGefallen zu tun, sozusagen als Hausaufgabe, bastelte ich ein paar Sätze zusammen, in denen ich meinen Cousin über die Familiengeschichte befragte. Als sie den Brief nach Grammatik-und Rechtschreibfehlern durchgesehen hatte, schickte ich ihn in die Schweiz.
Der Französischunterricht half mir wiederum bei meinem zweiten Projekt. »Was für ein wunderbarer Beruf für eine Frau!« schwärmte Madame Sentier, als sie hörte, daß ich Hebamme war und mich auch in Frankreich qualifizieren wollte. »Was für eine edle Aufgabe!« Ich mochte sie zu sehr, um mich über ihre romantischen Ansichten zu ärgern, also erzählte ich ihr nichts von dem Mißtrauen, mit dem mein Berufsstand von Ärzten, Krankenhäusern, Versicherungen und sogar von schwangeren Frauen behandelt wurde. Auch die schlaflosen Nächte
Weitere Kostenlose Bücher