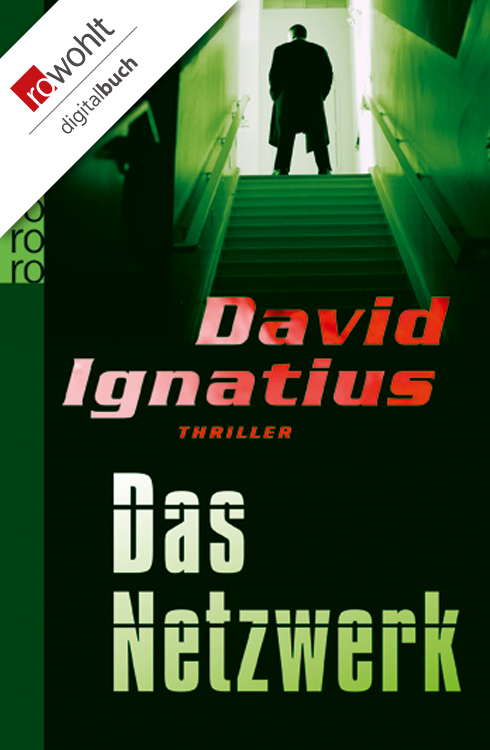![Das Netzwerk]()
Das Netzwerk
gemeint.
Die beiden Frauen wirkten alles andere als auffällig, als sie das Restaurant Jean-Pierre an der K Street betraten: Margaret im braunen Tweedkostüm, unter dem sich ihre Figur kaum erahnen ließ, Anna im grauen Kaschmirkleid, das ihre dezent betonte. Zwei attraktive, gebildete Frauen aus zwei Generationen, eine Mutter mit ihrer Tochter vielleicht, oder doch eher eine elegante, unverheiratete Tante, die ihre Lieblingsnichte zum Essen ausführt. Für alles Mögliche hätte man sie halten können, nur nicht für das, was sie waren. Und genau darin lag, wie Margaret immer wieder betonte, einer der vielen Vorteile, die man als Frau beim Geheimdienst hatte.
Anna ließ sich vom Oberkellner den Mantel abnehmen. Draußen war es empfindlich kühl. Dann streifte sie ihren Seidenschal ab und warf den Kopf in den Nacken, um ihr langes schwarzes Haar auszuschütteln, ehe sie dem Kellner und Margaret zu einem ruhigen Tisch im hinteren Teil des Restaurants folgte. Sie verhielt sich natürlich und ungekünstelt, zog aber dennoch die Blicke verschiedener männlicher Gäste auf sich.
«Einen Vorbehalt habe ich ja nach wie vor gegen dich», sagte Margaret, nachdem sie Platz genommen hatten. «Du bist einfach zu hübsch für diese Arbeit.»
Etwas Ähnliches hatte sie bereits vor einem Jahr gesagt, als Anna zum ersten Mal Interesse an der Geheimdienstarbeit bekundet hatte – damals, als sie mit ihrer Doktorarbeit nicht recht vorankam, mit einem Mann zusammenlebte, den sie nicht mehr liebte, und ganz generell das Gefühl hatte, explodieren zu müssen. Margaret hatte ihr anfangs davon abgeraten, zur CIA zu gehen. «Falls du dir damit etwas beweisen willst, dann lass es bleiben», hatte sie gesagt. «Frauen, die es den Männern zeigen wollen, können wir ebenso wenig brauchen wie solche, die ihnen den Kopf verdrehen.» Die Bemerkung hatte Anna getroffen, doch die Botschaft war angekommen. Schönheit war ein Risiko, weil sie zu viel Aufmerksamkeit erregte.
«Ich bin heute in Feierlaune», verkündete sie jetzt und zündete sich eine Zigarette an.
Einmal davon abgesehen, dass sie vielleicht etwas zu gut aussah, war Anna im Grunde wie geschaffen für die Geheimdienstarbeit. Ihr Vater war im auswärtigen Dienst gewesen, und sie hatte schon als Kind die Welt bereist, Fremdsprachen gelernt und fremde Kulturen erlebt. Ihre Mutter war an Krebs gestorben, als Anna gerade in die Pubertät kam, was ihre Bindung an den Vater noch verstärkt hatte. In gewisser Weise war sie bis heutedie Diplomatentochter geblieben, die fasziniert durch den Türspalt in sein Arbeitszimmer spähte, diesen verrauchten Raum, wo er las und seine Telegramme formulierte – nur dass die Tür inzwischen offen stand und sie einfach hineingehen konnte. So gesehen entsprach sie genau der neuen Erbfolgelinie, die sich in den Siebzigerjahren in der bürgerlichen Oberschicht zu etablieren begann. Während die Söhne ihre Zeit im Sommerhaus in Maine verbrachten oder sich in New Mexico ihren astrologischen Studien hingaben, standen die Töchter in den Startlöchern, um ihren Platz in den großen Anwaltskanzleien und Bankhäusern einzunehmen. Und natürlich auch in der CIA.
«Wer ist Edward Stone?» Anna blies eine Rauchwolke in die Luft.
«Warum in aller Welt willst du das wissen?»
«Ich hatte vor ein paar Tagen das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Er war unglaublich nett, aber mir ist nicht ganz klar geworden, was er eigentlich von mir wollte.»
«Das ist so seine Art», sagte Margaret. «Stone sagt einem nie, was er will. Darauf muss man selber kommen.»
«Dann kennst du ihn also.»
«Selbstverständlich. Du weißt doch: Ich kenne sie alle.»
«Was macht er denn?»
«Das weiß ich auch nicht so genau. Früher hat er die Nahostabteilung geleitet, aber nach allem, was man hört, hat er sich inzwischen etwas eigenes aufgebaut.»
«Was heißt das?»
«Das heißt: Ich weiß es wirklich nicht.»
«Hat er irgendetwas mit der Sowjetunion zu tun?»
«Pst.»
Der Kellner war an ihren Tisch getreten. Margaret bestellteeinen Martini mit Tanqueray, ohne Eis, aber mit einer Scheibe Zitrone. Anna nahm dasselbe. Es gab schließlich etwas zu feiern. Der Kellner wirkte überrascht. In der Gastronomie gelten zwei Frauen, die zusammen essen gehen, als knickrig: Sie trinken nichts, bestellen nur Salat und geben genau zehn Prozent Trinkgeld. Für sie hat es einfach nicht denselben Reiz des Handfesten wie für Männer, in einem Restaurant viel Geld auszugeben. Margaret hatte
Weitere Kostenlose Bücher