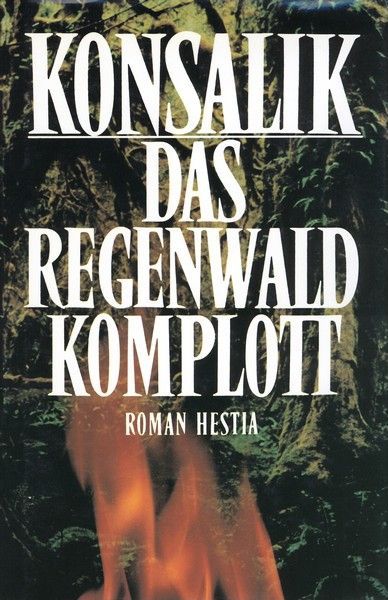![Das Regenwaldkomplott]()
Das Regenwaldkomplott
von der Gier nach Geld.
Geraldo Ribateio hatte eine undankbare und gefährliche Arbeit übernommen, als er das Kommando über die Polizeistation in Santo Antônio antrat. Er befehligte zwanzig Polizisten und bewohnte mit ihnen einen eigenen Neubau, gleich neben dem langgestreckten Gebäude der Mission. Es war ein idealer Platz. Die Straße führte zwei Kilometer nördlich an Santo Antônio vorbei, auf dem Rio Parima konnte man mit einem Boot aus Aluminium den Fluß hinauf zu den Goldminen fahren, ohne eine Stromschnelle passieren zu müssen. Es gab eine gute Landebahn für die kleinen Flugzeuge aus Boa Vista, die Versorgung klappte durch diese Luftbrücke hervorragend, die neue moderne Funkstelle verband ihn mit der übrigen Welt. Es gab keine unerfüllten Wünsche mehr bis auf einen: Es fehlten die Frauen.
Und noch ein Wunsch war nicht zu erfüllen: Verstärkung. Zwanzig Polizisten für 36.000 Goldgräber im Gebiet von Santo Antônio – das war lächerlich, das war eine Farce. Fast jeden Tag wurden Garimpeiros in den Camps, im Wald, am Fluß oder in den Minen gefunden. Erschossen, erwürgt, erstickt, an dicken Baumästen aufgehängt, erstochen oder mit eingeschlagenem Schädel. Es war völlig sinnlos, nach den Mördern zu suchen, die Garimpeiros schwiegen oder zuckten bedauernd mit den Schultern. Nichts gehört und nichts gesehen, nein, auch nicht ein Flüstern in den Läden, in den Bars oder bei den Huren. Man wollte ja schließlich weiterleben und sein sauer verdientes Geld verjubeln. Ein paar Tote – großes Achselzucken, treuherzige Blicke, ein freundliches Grinsen. Camaradas , was macht ihr euch für eine Mühe? Wozu? Morgen sind sie begraben, und übermorgen hat sie keiner gekannt.
Zwanzig Polizisten für 36.000 Goldgräber, Halunken, Glücksritter und Halsabschneider. Wenn also ein Toter gefunden wurde, forschte man nicht weiter. Man registrierte ihn bloß noch im Berichtsbuch. Die meisten hatten sowieso falsche Namen, genaugenommen konnte man sich die Eintragung auch noch sparen.
Die Sergentos Moaco und Perinha bremsten ihren Jeep vorsichtig vor dem Polizeigebäude, damit der Tote nicht wieder auf den Karton zwischen den Hintersitzen fiel. Perinha sah seinen Kameraden fragend an und zögerte, aus dem Wagen zu steigen.
»Sagst du's ihm!«
Moaco nickte. Er sprang aus dem Wagen, setzte seine Mütze auf und verschwand in der Station. Ribateio saß in einem Korbsessel, las in einer Zeitschrift und blickte kurz auf, als Moaco eintrat und sich räusperte.
»Etwas Besonderes, Alberto?« fragte er.
»Nichts Besonderes, Tenente.« Moaco holte tief Luft. »Wir sind mit Senhor Ramos gekommen.«
»Ja, er ist gestern abend zu den Camps gefahren.«
»Und mit 'nem Pfeil in der Brust kommt er zurück.«
Ribateio hob den Kopf. Noch begriff er nicht, was Moaco da sagte, nur das Wort Pfeil blieb hängen.
»Pfeil? Wieso Pfeil?« fragte er erstaunt.
»Senhor Ramos ist mit einem Pfeil erschossen worden. Wir haben ihn in seinem Ranch Rover hergebracht.«
Wenn eine Granate neben Ribateio eingeschlagen hätte, wäre die Wirkung nicht anders gewesen. Der Tenente schoß aus dem Sessel hoch, stieß ihn dabei um und stürzte auf den Sergento zu. Moaco fing ihn auf, sonst hätte Ribateio das Gleichgewicht verloren.
»Hab ich euch nicht gesagt«, schrie er und stand dann fest auf seinen Beinen, »ihr sollt nicht schon am Morgen saufen?! Wo ist Perinha?!«
»Bei dem Toten, Tenente.«
»Bei was?!« Ribateio zog den Kopf ein. Ein kalter Schauer lief ihm plötzlich den Rücken hinunter.
»Senhor Ramos ist tot. Erschossen. Mit einem langen, roten Pfeil. Wie die anderen, Tenente.«
Ribateio gab keine Antwort, stieß Moaco zur Seite und rannte ins Freie. Perinha stand neben dem Jeep und grüßte zackig, als der Tenente auf ihn zustürzte. Dann stand Ribateio vor dem Toten und starrte ihm in das bleiche Gesicht.
Auch im Missionshaus schien man etwas bemerkt zu haben. Pater Vincence kam über den Platz. Ihm folgte Pater Ernesto. Er war in den vergangenen Jahren grau geworden, dicke Strähnen zogen sich durch sein ehemals schwarzes Haar. Er war jetzt fast sechzig Jahre alt, war aber noch ein großer, starker Kerl, der die Yanomami-Sprache wie sein Italienisch sprach und den die Indios ehrfurchtsvoll den ›Großen Vater‹ nannten.
Ribateio wischte sich über sein plötzlich schweißnasses Gesicht und wandte sich ab, als Pater Vincence noch fünf Schritte von ihm entfernt war.
»Ramos«, sagte er laut, aber seine Stimme bebte
Weitere Kostenlose Bücher