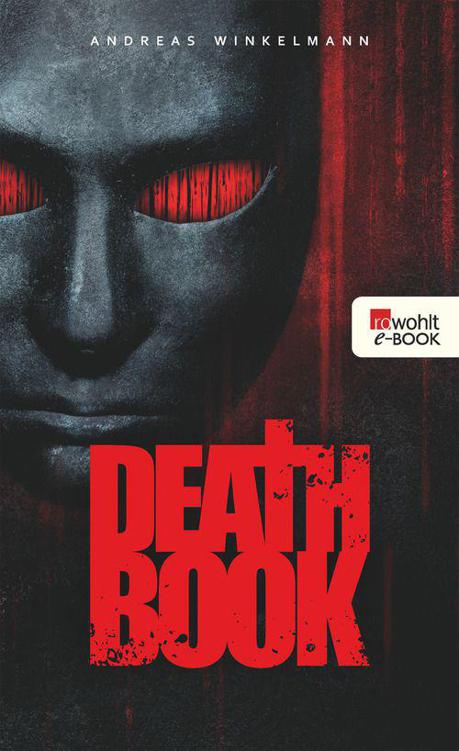![Deathbook (German Edition)]()
Deathbook (German Edition)
sie längst schlafen sollen. Morgen war ihr erster Arbeitstag nach dem Tod ihrer Mutter. Da der Supermarkt um sieben öffnete, musste sie bereits um sechs dort sein. Der normale Alltag begann, und auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, dass es je wieder so werden würde wie früher, freute Ann-Christin sich doch darauf, endlich wieder rauszukommen.
Nach der Beerdigung war ihr klargeworden, wie einsam Mama und sie gelebt hatten. Zu zweit war es erträglich gewesen, manchmal sogar schön, weil sich durch ihre Situation eine besondere Nähe zwischen ihnen entwickelt hatte. Vielleicht hatten sie sich in der Rolle der Außenseiter sogar wohl gefühlt, denn sie bot Sicherheit. Wer sich nicht auf andere Menschen einließ, der konnte von ihnen auch nicht verletzt werden. Aber jetzt, da sie allein war, kam sich Ann-Christin so vor, als befände sie sich auf einem fremden Trabanten, der den Planeten der anderen in sicherer Entfernung umkreiste.
Gustav war nicht wiederaufgetaucht. Darüber war sie froh. Leider hatte Tante Verena sich auch nicht mehr blicken lassen und auch nicht angerufen. Wahrscheinlich verbot Gustav es ihr. Sie hatte ja schon immer getan, was er wollte.
Von der Familie konnte Ann-Christin also keine Hilfe erwarten. Sie musste ihr Leben selbst in den Griff bekommen. Morgen zur Arbeit zu gehen war ein erster Schritt in diese Richtung. Es würde ihr schwerfallen, und doch war sie fest entschlossen durchzuhalten.
Ihr Handy vibrierte auf der Tischplatte. Sie erschrak.
Außer Gustav und Verena kannte niemand ihre Nummer.
Eine SMS war eingegangen.
Ann-Christin öffnete sie.
Du wirst den Tod nie verstehen, wenn du dich nicht öffnest, Ann-Christin. Vertrau mir. Wir sind seelenverwandt. Vom ersten Moment an, als ich dich sah, habe ich es gewusst. Nie habe ich mich einem Menschen näher gefühlt. Ich habe die ganze Nacht im Chat auf dich gewartet. Bitte, verstoß mich nicht. Ich will ehrlich sein zu dir, deshalb schicke ich dir dieses Video. Sei mir nicht böse, ich hab es aufgenommen, weil du mich faszinierst.
Die SMS hatte einen Anhang.
Ohne nachzudenken, klickte Ann-Christin darauf, und ihr Handy spielte ein Video ab.
Sie sah sich selbst, wie sie mit der schweren Einkaufstüte die dunkle Straße hinunterging. Schnitt. Sie trat mit dem schwarzen Umschlag in der Hand vors Haus, ging vor bis zur Pforte und schaute unsicher in alle Richtungen. Die Kamera zoomte auf ihr Gesicht. Sie sah ihre eigenen blauen Augen, die ängstlich die Umgebung absuchten. Dann tastete sie sich rückwärts zur Haustür zurück und schlug sie zu. Schnitt. Die nächste Einstellung zeigte sie hinter dem Küchenfenster. Auch hier zoomte die Kamera wieder ganz nah an ihr Gesicht heran.
Ann-Christin warf das Handy auf den Tisch, als hätte sie sich daran verbrannt. Bis eben war das Gerät für sie eine Verbindung zur Außenwelt gewesen. Jetzt wurde es zur Bedrohung. Nicht sie allein entschied, wer und was sie erreichte, sondern irgendjemand in der Welt dort draußen.
Mit voller Wucht überkam sie die Angst, die sie doch schon vertrieben geglaubt hatte. Sie hatte sich nicht getäuscht: Er verfolgte sie. Wahrscheinlich schon von dem Tag an, an dem ihre Mutter gestorben war. Damals hatte sie es zum ersten Mal gespürt.
Ein entsetzlicher Gedanke nahm in ihr Gestalt an.
War dieser Anima Moribunda etwa schuld an Mamas Tod?
Im Bruchteil einer Sekunde verwandelte sich ihre Angst in Wut.
Sie schnappte sich das Handy und tippte eine Antwort- SMS ein:
Lass mich endlich in Ruhe, du verdammter Stalker. Wir sind nicht seelenverwandt, und ich will nichts mit dir zu tun haben.
U nten bleiben!»
Ein Zischen, mehr nicht, kaum wahrnehmbar. Es klang nicht wie eine menschliche Stimme.
«Unten bleiben, sonst sterben Sie noch heute Nacht.»
Überhaupt schien alles ganz weit entfernt zu sein. Ich hörte die Worte zwar, begriff sie aber nicht. Ich war viel zu sehr mit meinen Schmerzen beschäftigt. Mein Körper fühlte sich an, als hätte jemand Nadeln hineingestochen, Hunderte von Nadeln. Sie waren lang und drangen tief ins Fleisch. Es gab keine Stelle, die nicht schmerzte. Mein Kopf drohte zu bersten. Tief darin pulsierten heiße Stiche.
Nach und nach nahm ich meine Umgebung wahr. Ich lag quer über Fahrer und Beifahrersitz, der Schalthebel drückte gegen meinen Brustkorb. Der linke Fuß war zwischen der geschlossenen Tür und dem Sitz eingeklemmt, das rechte Bein lag im Fußraum. Meine Arme konnte ich im ersten Moment nicht finden.
Weitere Kostenlose Bücher