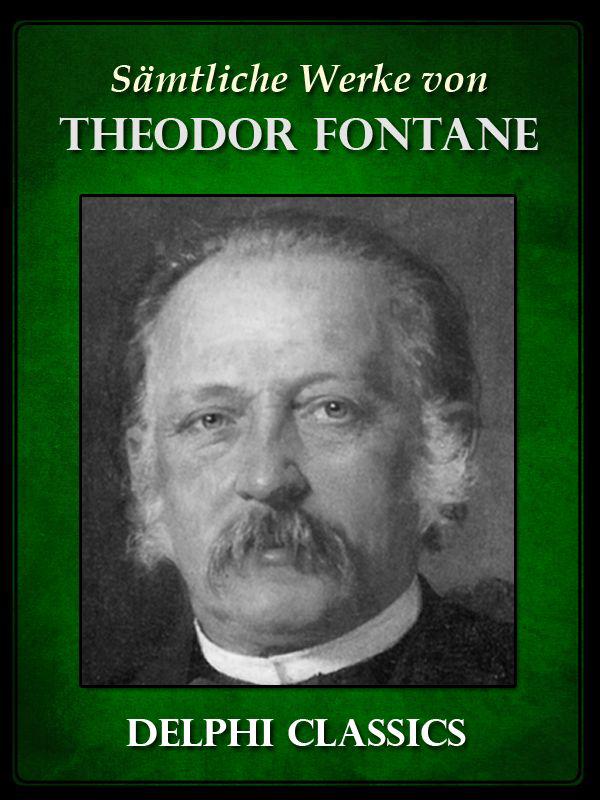![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
mittags und abends geläutet werde, und wollen auch, daß, wenn bisher in dem Filialdorfe Stolpe nicht geläutet wurde, dieses sogleich eingeführt werde.«
Die Peter-Pauls-Kirche zu Nikolskoë verfolgt also, um an dieser Stelle zu rekapitulieren, neben ihrer gottesdienstlichen Aufgabe vor allem zweierlei : sie soll als Bild in der Landschaft wirken und soll zweitens mit ihren Glocken die Stille romantisch-feierlichen Klanges unterbrechen. Und beides ist erreicht worden. Im übrigen gibt sich das Innere der Kirche ziemlich nüchtern, welche Nüchternheit auch durch drei die Kanzel zierende Medaillonbildchen nur wenig gemindert wird, weil alle drei Bildchen, so hübsch und bemerkenswert sie sind, nicht unmittelbar und durch sich selbst, sondern erst durch ihre Geschichte zur Geltung kommen. Zwei davon, die Apostel Petrus und Paulus , sind wertvolle Mosaikarbeiten (besonders Petrus mit dem Unterkleide von Lapislazuli), die Papst Clemens XIII. in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem König Friedrich II. zum Geschenk machte. Beide Bildnisse gehörten der Bildergalerie zu Sanssouci an, von der sie, während des Baus der Kirche, hierher kamen. Das dritte Medaillonbild ist ein »Christuskopf mit der Dornenkrone« nach Guido Reni und rührt nicht von einem kopierenden italienischen Meister, sondern vom Lehrer und Küster Fischer her, der, während der letzten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelms IV., an der Schule von Nikolskoë amtierte. Fischer bat um die Erlaubnis, dies Bild machen und, wenn gut befunden, in das noch leere Kanzelfeld einsetzen zu dürfen. Nach erhaltener Erlaubnis begann er mit sorgfältiger Präparierung einer Tontafel. Dann schritt er zu einer majolikaartigen Bemalung derselben und brannte die Farben, unter Benutzung seines eigenen Backofens, ein. Einen ihm angebotenen Ehrensold lehnte er ab und bat nur um Bewilligung von »frei Arzt und Arznei«, welche Bitte mit dem Hinzufügen gewährt wurde, »daß diese Bewilligung nicht nur ihm , sondern ein für allemal allen Lehrern und Küstern an der Schule beziehungsweise Kirche von Nikolskoë zugute kommen solle«. So wurde sein Fleiß und seine Kunst zum Segen auch für seine Nachfolger, die sich, bei zufällig viel Krankheit, ihres Amtsvorgängers in besonderer Dankbarkeit erinnern.
In der Kirche von Nikolskoë blieb durch vierzig Jahre hin (von 1837 bis 77) so ziemlich alles beim alten. Erst das letztgenannte Jahr führte Veränderungen herauf. Am 18. Januar 1877 war die Prinzessin Karl gestorben und hatte, wohl in Erinnerung an hier trostreich verlebte Stunden, in ihrem Testamente den Wunsch ausgesprochen, »in der Peter-Pauls-Kirche zu Nikolskoë zu ruhn«. Im Einklange hiermit schritt man, nach einem Entwurfe des Hofbaumeisters Persius, zur Erbauung einer mit weißem, blauem und dunkelgrauem schlesischen Marmor getäfelten und zur Aufnahme von acht Särgen ausreichenden Gruft, in der am 24. Mai früh sechs Uhr die Prinzessin – deren Sarg bis dahin in Charlottenburg gestanden hatte – beigesetzt wurde.
Von dem Tag an war die Gruft zu Nikolskoë die designierte Begräbnisstätte der Karlschen Linie des Hauses Hohenzollern:
am 24. Januar 1883 wurde der alte Prinz Karl hier beigesetzt,
am 18. Juni 1885 Prinz Friedrich Karl .
Und an den Geburts- und Sterbetagen legen Dankbarkeit und Liebe hier ihre Kränze nieder.
Anhang zum Kapitel »Liebenberg«
Vom 14. Oktober 1806 bis 18. Oktober 1813
Sieben Jahre Welt- und Landesgeschichte vom Standpunkt eines märkischen Herrensitzes aus
In einer Reihe von Aufsätzen über »Liebenberg und die Hertefelds«, die zu Beginn dieses Jahres an ebendieser Stelle veröffentlicht wurden, hab ich vor allem auch die Gestalt Friedrich Leopolds von H. (des Vaters des »letzten Hertefelds«) zu zeichnen gesucht, und zwar nach seinen eigenen, an seine Tochter Alexandrine Danckelmann gerichteten Briefen.
Ebendiese Briefe jedoch geben nicht bloß ein Bild seiner Person, sondern zugleich auch ein Bild seiner Zeit , an welches Zeitbildliche sich aus dem Moment heraus überall auch ein Zeitraisonnement anschließt. Er war so scharf in Beobachtung und Urteil, daß es ihm unmöglich war zu referieren, ohne zu kritisieren. Ob diese seine Kritik überall eine richtige war, ist mindestens zweifelhaft. Er versah es, mein ich, darin, daß er, um beispielsweise nur einen Namen, den Hardenbergs, zu nennen, Person und Sache nicht ausreichend zu scheiden, die Schwierigkeiten der Lage,
Weitere Kostenlose Bücher