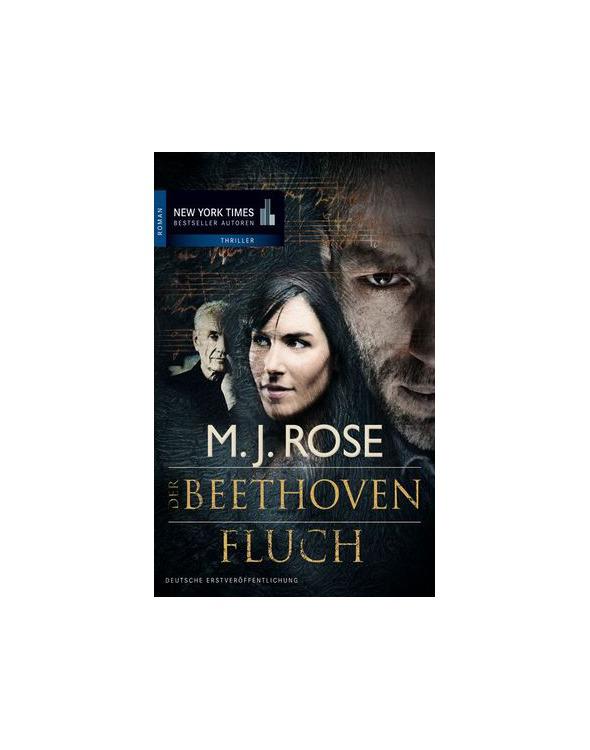![Der Beethoven-Fluch]()
Der Beethoven-Fluch
berühren. Eines zeigte die Aufnahme allerdings nicht: Im nächsten Moment hatte Pauline damals die Hand der kleinen Meer vom Gesicht genommen, weil sie die mitleidige Geste nicht ertragen konnte, nicht einmal von ihrem eigenen Kind. Ungeachtet dieser Zurückweisung hatte Meer auch weiterhin versucht, die Einsamkeit aus dem Blick ihrer Mutter zu verscheuchen. Als sie schließlich erwachsen genug war, um es auf andere Weise zu probieren, war es zu spät.
Seinerzeit war Meer achtzehn Jahre alt und Studienanfängerin an der Juilliard gewesen; die Juilliard School, New Yorker Musikkonservatorium und Schauspielschule, genoss einen hervorragenden Ruf. Eines Nachmittags hatte ihr Vater sie nach einer Vorlesung zu einem Spaziergang durch den Park abgeholt. Sie saßen auf einer Bank am Rande ihres alten Spielplatzes, und während die Sonne unterging, erzählte Jeremy Meer von der Krankheit ihrer Mutter. Obwohl ihre Eltern damals schon seit sechs Jahren geschieden waren, war er aus Wien zurückgekehrt, um diese Bürde auf sich zu nehmen. Und dann bot er seiner wie betäubt dasitzenden Tochter ein frisches Taschentuch und schloss sie in die Arme. Dass Pauline ihre Leukämie vor der Tochter geheim gehalten und erst ihrem geschiedenen Mann gestattet hatte, sie davon in Kenntnis zu setzen, das war für Meer zwar eine herbe Enttäuschung. Aber eine Überraschung war es eigentlich nicht. In den letzten Monaten danach, als Pauline weiterhin ihre letzte Kraft und Konzentration in erlesenes Porzellan und Gläser steckte, in Spiegel, Teppiche, Sofas, Kommoden und Etageren in ihrem Antiquitätenladen, da wehrte sie sich mit Händen und Füßen dagegen, dass Meer überhaupt irgendwelche Energie auf sie verschwendete. Während des gesamten Behandlungszeitraums ließ Pauline niemals erkennen, dass etwas mit ihr nicht stimmte oder dass sie litt oder Angst hatte. Dann fiel sie ohne jede Vorwarnung ins Koma und starb zwei Wochen später. Da war es zu spät für Mutter und Tochter, noch das möglicherweise entscheidende Gespräch zu führen.
“Sie sind ihr wie aus dem Gesicht geschnitten”, bemerkte Sebastian.
“Eher weniger. Sie war wunderschön …”
Sebastian ließ nicht locker, doch da kam Inspektor Fieske herein. “Es hat einen Unfall gegeben”, sagte er, wobei er Meer geradewegs ansah. Sie lauschte dem Bericht des Inspektors. Das Foto hielt sie dabei krampfhaft in den Händen.
16. KAPITEL
C yberspace
Samstag, 26. April – 12:25 Uhr
Der Bildschirmschoner war ein unendliches, dunkelblaues Universum, gesprenkelt mit Sternen, die sich langsam im Kreise drehten. Das einzig Statische war das Icon für die E-Mails. Und das war besorgniserregend. Laut Plan hätte die Information längst durch die Fiberglaskabel rauschen und eintreffen müssen … Na endlich! Das erwartete Symbol erschien auf dem Schirm. Ein Doppelklick mit der Maus, und die E-Mail war geöffnet. Eine rasche Durchsicht. Bloß die läppische Beschreibung eines Familienurlaubs. Nicht nötig, das alles im Detail zu lesen. Stattdessen wurde der Inhalt über die Zwischenablage in ein Entschlüsselungsprogramm kopiert, und knapp eine Minute später verwandelte sich die Schilderung einer Urlaubswoche am Strand in einen Brief von Beethoven an Antonie Brentano.
Eine erste Lektüre.
Eine zweite.
Die Wörter waren zwar verlockend, aber nicht schlüssig. Stimmte dieser Satz wohl? Was bedeutete jener? Beethoven erwähnte den Librettisten Stephan von Breuning und Erzherzog Rudolf und behauptete, er habe ihnen Anhaltspunkte übermittelt. Ja, aber was für welche? Die Spieleschatulle – war sie etwa auch so ein Schlüssel? Das Ganze glich einer Schatzkarte. Man musste sie noch einmal studieren, diesmal langsamer, angefangen mit der Anredeformel, die in sich bereits einen großartigen Fund darstellte. Ein neu entdeckter Brief, geschrieben von Beethoven an die Frau, die nach Ansicht vieler Historiker seine einzige wahre Liebe war – der konnte Hunderttausende von Euro wert sein. Vielleicht eine Million. Verglichen mit den im Schreiben enthaltenen Hinweisen war der Geldwert indes nebensächlich, denn letzten Endes ging es um Macht und Glauben. Um Mögliches und Unmögliches. Um Legenden und Mythen, um Mutmaßungen und Fleisch gewordene Hypothesen. Und es ging um eine Flöte – möglicherweise die Vorläuferin eines in den Siebzigerjahren von Robert Allan Monroe erfundenen Geräts, das Harmonien im Bereich von Alpha-und Thetafrequenzen verwandte. Was, wenn es ein Instrument gab,
Weitere Kostenlose Bücher