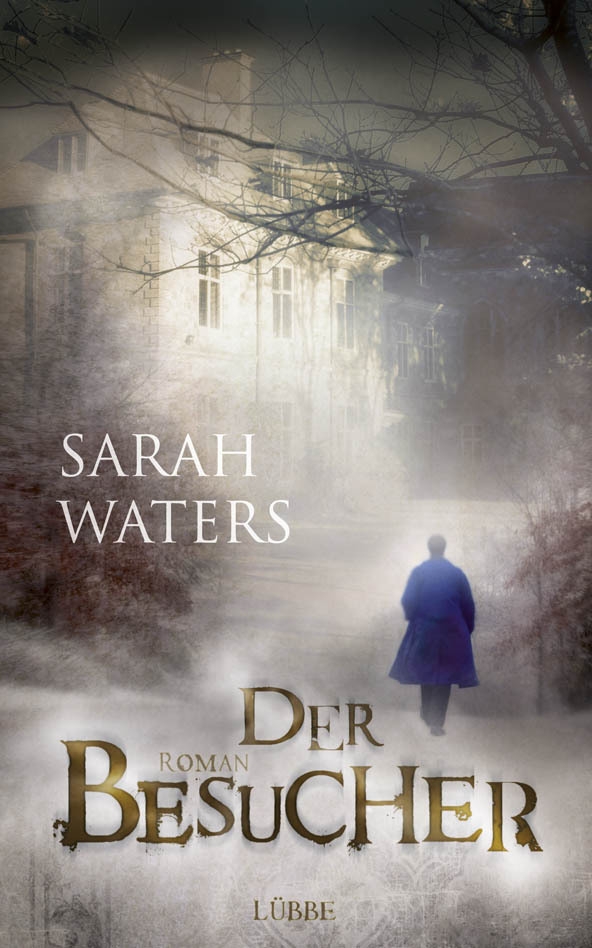![Der Besucher - Roman]()
Der Besucher - Roman
packte eine der Eicheln und versuchte sie aus ihrer Umgebung zu lösen, und als mir das mit den bloßen Fingern nicht gelang, zog ich mein Taschenmesser hervor und stemmte es in den Stuck. Das tat ich keineswegs aus Zerstörungswut; ich war weder ein boshaftes noch zerstörerisch veranlagtes Kind. Es war vielmehr so, dass ich aus bloßer Bewunderung für das Haus unbedingt ein Stück davon besitzen wollte – oder besser gesagt: Die große Bewunderung, die ich für das Haus empfand und die ein durchschnittlich veranlagtes Kind wahrscheinlich gar nicht in dem Maße empfunden hätte, schien mir überhaupt erst das Recht zu dieser Tat zu verleihen. Ich wollte mir einen Teil der Schönheit sichern, gerade so, wie ein Mann sich eine Locke von dem Haar des Mädchens bewahren möchte, in das er sich unsterblich verliebt hat.
Ich fürchte, die Eichel gab meinen Bemühungen schließlich nach – allerdings weniger akkurat, als ich es erwartet hatte, und als sie sich mit einer unschönen Bruchkante aus der Wand löste, bröselten feinkörniger Sand und weißer Staub zu Boden. Ich weiß noch, dass ich darüber ziemlich enttäuscht war; ich hatte wohl angenommen, dass sie aus Marmor sei.
Doch niemand kam; niemand ertappte mich bei meiner Tat. Es war, wie es so schön heißt, das Werk eines Augenblicks. Ich stopfte die Eichel in meine Hosentasche und schlüpfte wieder hinter den Vorhang. Kurz darauf kehrte das Stubenmädchen zurück und nahm mich wieder mit nach unten; meine Mutter und ich verabschiedeten uns vom Küchenpersonal und gingen zurück zu meinem Vater in den Garten. Ich konnte das harte Gipsstück in meiner Tasche spüren und empfand eine Mischung aus Übelkeit und Erregung. Plötzlich bekam ich es mit der Angst zu tun, dass Colonel Ayres, ein furchteinflößender Mann, den Schaden entdecken und die Feierlichkeiten beenden würde. Doch der Nachmittag ging ohne besondere Vorkommnisse dahin, bis die bläuliche Abenddämmerung sich herabsenkte. Meine Eltern und ich traten gemeinsam mit etlichen anderen Leuten aus Lidcote den langen Heimweg durch die Felder an, begleitet nur von den Fledermäusen, die wie an unsichtbaren Fädchen an uns vorüberhuschten.
Natürlich entdeckte meine Mutter die Eichel irgendwann. Ich hatte sie immer wieder aus der Tasche gezogen und zurückgesteckt, und sie hatte eine Kreidespur auf dem grauen Flanellstoff meiner kurzen Hosen hinterlassen. Als meine Mutter endlich begriff, worum es sich bei dem merkwürdigen Ding in ihrer Hand handelte, wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. Doch sie gab mir weder eine Ohrfeige noch erzählte sie meinem Vater von dem Vorfall; für solche Auseinandersetzungen fehlte ihr immer der Mut. Stattdessen schaute sie mich bloß vorwurfsvoll mit Tränen in den Augen an, als schäme sie sich meiner.
»Ein gescheiter Bursche wie du sollte es doch eigentlich besser wissen«, hat sie vermutlich gesagt.
Solche Bemerkungen musste ich mir als Kind ständig von den Erwachsenen anhören. Meine Eltern, meine Onkel, die Lehrer – jeder Erwachsene, der sich für mein Fortkommen in der Welt interessierte, gebrauchte diese oder ähnliche Formulierungen, und sie versetzten mich jedes Mal in hilflose, stille Wut, denn einerseits wollte ich unbedingt meinem Ruf gerecht werden, ein gescheiter Junge zu sein, auf der anderen Seite aber kam es mir sehr ungerecht vor, dass diese Intelligenz, um die ich nie gebeten hatte, plötzlich dazu verwendet wurde, mich abzukanzeln.
Die Eichel wurde in den Ofen geworfen. Ich fand die verkohlten Reste am nächsten Tag in der Asche wieder. Doch jenes Jahr dürfte ohnehin das letzte große in der Geschichte von Hundreds Hall gewesen sein. Die Feierlichkeiten zum nächsten Empire Day wurden von einer anderen Familie in einem der benachbarten Herrenhäuser ausgerichtet; auf Hundreds Hall hatte ein stetiger Niedergang begonnen. Wenig später starb die Tochter der Ayres, und Mrs. Ayres und der Colonel zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ich kann mich noch dunkel an die Geburten der beiden folgenden Kinder erinnern, Caroline und Roderick, doch da war ich schon auf dem Leamington College und hatte genug mit meinen eigenen Sorgen zu tun. Meine Mutter starb, als ich fünfzehn war. Wie sich herausstellte, hatte sie während meiner Kindheit eine Fehlgeburt nach der anderen erlitten, und an der letzten war sie dann gestorben. Mein Vater lebte gerade noch so lange, dass er den Abschluss meines Medizinstudiums und meine Approbation mitbekam.
Weitere Kostenlose Bücher